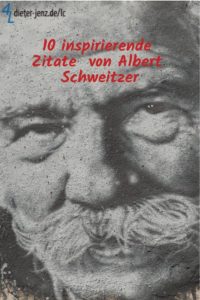Inspirierende Zitate von Albert Schweitzer, Träger des Friedensnobelpreises und bekannt als „Urwaldarzt“.
Albert Schweitzer (1875-1965) war ein deutsch-französischer Arzt, Philosoph, evangelischer Theologe, Organist, Musikwissenschaftler und Pazifist. Schweitzer, der „Urwaldarzt“, gründete 1913 ein Krankenhaus in Lambaréné im zentralafrikanischen Gabun. Er veröffentlichte theologische und philosophische Schriften, Arbeiten zur Musik, insbesondere zu Johann Sebastian Bach, sowie autobiographische Schriften.
Abenteuer statt sicherer akademischer Karriere
Was bringt einen Dozenten für Theologie dazu, im Alter von 30 Jahren seine bisherige Karriere aufzugeben und ein acht Jahre dauerndes Medizinstudium zu beginnen? In dem Buch „Selbstzeugnisse“ ist beschrieben, wie es dazu kam und welches die treibenden Faktoren waren. Er sah eine humanitäre Aufgabe an der Bevölkerung im damaligen Französisch-Äquatorialafrika, die jedoch keineswegs ausreichend erfüllt wurde.
Mit seiner Frau beschloss er, in Gabun als Arzt tätig zu werden. Die Finanzmittel für das Vorhaben musste Albert Schweitzer selbst aufbringen und setzte dafür seine eigenen Autorenhonorare und auch Spenden von Freunden ein.
Der spätere Aufbau des Krankenhauses in Lambaréné gelang unter vielen Mühen und begleitet von mancherlei Rückschlägen. Wie hielt Schweitzer alle diese Mühen und Rückschläge aus?
Für Albert Schweitzer wäre es viel bequemer gewesen, seine akademische Karriere an der Universität Straßburg fortzusetzen und sich irgendwann in einen finanziell gesicherten Ruhestand zu verabschieden. Er hätte sich nicht dem tropischen Klima aussetzen müssen, hätte sich nicht mit unzuverlässigen Einheimischen herumschlagen müssen, hätte …
Albert Schweitzer war mit Begeisterung Arzt. Er erlebte in seiner Tätigkeit Glück und drückte dies mit den Worten „Leben erhalten ist das einzige Glück“ aus. Die Sinnhaftigkeit seiner Tätigkeit erfüllte ihn.
Die von Albert Schweitzer erhalten gebliebenen Zitate drücken „große Wahrheiten“ aus und spiegeln Lebenserfahrung und Sinnhaftigkeit eines Lebens wider. Erlebtes und Durchlebtes sind in prägnante Worte gekleidet.
Albert Schweitzers Leben ist einzigartig. Es lässt sich nicht nachahmen. Gleichwohl bieten die Zitate Stoff für das eigene Nachdenken über Themen wie „Begeisterung“, „Glück“, „Erfolg“ usw.
Von Authentizität geprägte, inspirierende Zitate von Albert Schweitzer spiegeln sein Leben und Wirken wider. Sie geben Einblick in seine Werte und Überzeugungen, während er an seinem Lebenswerk arbeitete.
Kultur, Mentalität, Sprache, Klima – enorme Herausforderungen
Seine Entscheidung, in Äquatorialafrika als Arzt tätig zu sein, brachte für Albert Schweitzer enorme Herausforderungen und damit verbundene Umstellungen mit sich. Er musste sich zwangsläufig auf die bestehenden Wertvorstellungen und erlernten Verhaltensweisen einer ethnischen Gruppe, der dort ansässigen Bevölkerung, einstellen. Deren Denk- und Verhaltensmuster, die Mentalität, unterschied sich fundamental von denen der Bevölkerung seiner elsässischen Heimat.
Hinzu kam die Sprachbarriere. Nur relativ wenige Menschen der einheimischen Bevölkerung verfügten über einen umfangreicheren Sprachschatz im Hinblick auf Französisch, die Sprache der damaligen Kolonialmacht. Schriftlich auf Französisch kommunizieren konnten noch viel weniger Menschen. Oft war Albert Schweitzer bei seiner Tätigkeit deshalb auf Dolmetscherdienste angewiesen.
Schließlich war auch das Klima eine Herausforderung für sich. Für Mitteleuropäer bedeutete die Anpassung an das Klima Äquatorialafrikas auch eine drastische Änderung des Lebens- und Arbeitsrhythmus.
In dem 1959 erschienenen Buch „Selbstzeugnisse“ finden sich Aufzeichnungen Albert Schweitzers, die einen Eindruck davon vermitteln, welchen Herausforderungen er sich gegenübersah. Die meisten Texte stammen aus der Zeit um das Jahr 1920. Manche Begriffe und Ausdrucksweisen in diesem Buch gelten heute als diskriminierend, waren aber vor rund hundert Jahren durchaus geläufig und keineswegs generell negativ konnotiert.
Wenn in der Folge Passagen aus diesem Buch wiedergegeben werden, so geschieht dies vor dem Hintergrund, die Erlebnisse und Erfahrungen Albert Schweitzers so wiederzugeben, wie er sie niederschrieb. Damit ist keineswegs der Gedanke oder die Absicht einer Herabwürdigung von ethnischen Gruppen oder einzelnen Menschen verbunden. Allerdings wurde der Text an die heute geltenden Rechtschreibregeln angepasst.
Umgang mit sozialen Fragen und Problemen
Albert Schweitzer nahm im Urwald viele soziale Probleme wahr. Zuweilen ergab sich ein Zwiespalt hinsichtlich in Europa und im Christentum verwurzelten Überzeugungen einerseits und der Lebensrealität der Einheimischen andererseits. In diesem Spannungsfeld beschritt er einen Weg des wertschätzenden und pragmatischen Umgangs mit der vorherrschenden Kultur und Mentalität der einheimischen Bevölkerung.
Exemplarisch seien an dieser Stelle die soziale Frage der Polygamie und der Stellung der Frau und die Frage der Beziehungen zwischen Weißen und Einheimischen kurz beleuchtet.
Polygamie und Stellung der Frau
In „Selbstzeugnisse“ finden sich dazu folgende Ausführungen Albert Schweitzers: „Wir kommen hierher mit dem Ideal der Monogamie. Die Missionare kämpfen mit allen Mitteln gegen die Polygamie und verlangen mancherorts von der Regierung, dass sie sie durch Gesetze verbiete. Andererseits müssen wir uns alle hier eingestehen, dass sie auf das innigste mit den gegebenen wirtschaftlichen und sozialen Zuständen zusammenhängt. Wo die Menschen in Bambushütten hausen und die Gesellschaft noch nicht so organisiert ist, dass eine Frau ihr Leben durch selbstständige Arbeit verdienen kann, ist für die unverheiratete Frau kein Platz. Voraussetzung aber für die Verheiratung aller Frauen ist die Polygamie.
Weiter: Im Urwald gibt es keine Kühe und keine Milchziegen. Also muss die Mutter ihr Kind lange an der Brust nähren, wenn es nicht zugrunde gehen soll. Die Polygamie wahrt das Recht des Kindes. Nach der Geburt hat die Frau das Recht und die Pflicht, drei Jahre lang nur ihrem Kinde zu leben. Sie ist vorerst nicht mehr Gattin, sondern nur Mutter. Oft verbringt sie diese Zeit zum großen Teil bei ihren Eltern. Nach drei Jahren findet das Fest der Entwöhnung statt, und sie kehrt wieder als Gattin in die Hütte ihres Mannes zurück. Dieses Leben für das Kind ist aber nur denkbar, wenn der Mann unterdessen eine andere Frau oder andere Frauen hatte, um den Haushalt und die Pflanzungen zu versorgen.
Noch eins. Es gibt bei den Naturvölkern keine unversorgten Witwen und keine verlassenen Waisen. Der nächste Verwandte erbt die Frau des Verstorbenen und muss sie und ihre Kinder erhalten. Sie tritt in die Rechte seiner Frau ein, wenn sie auch nachher mit seiner Genehmigung einen anderen heiraten kann.
Bei primitiven Völkern an der Polygamie rütteln heißt also, den ganzen sozialen Aufbau ihrer Gesellschaft ins Wanken zu bringen. Dürfen wir dies, ohne zugleich imstande zu sein, eine neue, in die Verhältnisse passende soziale Ordnung zu schaffen? Wird nicht die Polygamie tatsächlich fortbestehen, nur dass die Nebenfrauen dann nicht mehr legitim, sondern illegitim sind? Diese Fragen machen den Missionaren viel zu schaffen.
[…] Das Verhältnis zwischen den Frauen ist gewöhnlich ein Gutes. Eine Negerin ist nicht gern die einzige Gattin, weil ihr dann die Unterhaltung der Pflanzung, die Sache der Frau ist, allein zufällt. Die Unterhaltung der Pflanzungen ist sehr mühevoll, weil sie gewöhnlich weit vom Dorfe an irgendeiner versteckten Stelle angelegt werden.Was ich von der Vielweiberei in meinem Spital gesehen habe, hat sich mir nicht von ihrer hässlichen Seite gezeigt. Einst kam ein kranker, schon älterer Häuptling mit zwei jungen Frauen. Als sein Befinden besorgniserregend wurde, erschien plötzlich eine dritte, die bedeutend älter war als die anderen. Es war die erste Gattin. Von jenem Tage an saß sie auf seinem Bett, hielt sein Haupt in ihrem Schoß und reichte ihm zu trinken. Die beiden jüngeren begegneten ihr mit Ehrerbietung, nahmen ihre Befehle entgegen und besorgten die Küche.
Es kann in diesem Lande vorkommen, dass ein vierzehnjähriger Knabe sich als ‚Familienvater‘ präsentiert. Dies geht so zu. Er hat von einem verstorbenen Verwandten eine Frau mit Kindern geerbt. Die Frau ist mit einem Mann eine neue Ehe eingegangen. Aber damit werden die Rechte des Knaben auf die Kinder und seine Pflichten gegen sie nicht berührt. Sind es Knaben, so muss er ihnen später eine Frau kaufen; sind es Mädchen, so müssen die, die sie heiraten wollen, ihm den Kaufpreis bezahlen.
Soll man gegen den Frauenkauf eifern oder ihn dulden? Handelt es sich darum, dass ein Mädchen, ohne befragt zu werden, dem Meistbietenden als Frau zugesprochen wird, so ist selbstverständlich zu protestieren. […] Worauf zu dringen ist, ist bei uns wie bei den Naturvölkern, dass es [das Geldgeschäft] nur ein Begleitumstand bleibe und die Wahl selbst nicht so bestimme, dass in Afrika die Frau und in Europa der Mann [durch die damals weitgehend übliche Mitgift] gekauft werde. Wir haben also nicht den Frauenkauf an sich zu bekämpfen, sondern nur erzieherisch auf die Eingeborenen zu wirken, dass sie das Mädchen nicht an den Meistbietenden geben, sondern an den, der es glücklich machen kann und für den es Zuneigung empfindet.
Gewöhnlich sind die Negermädchen auch gar nicht so unselbstständig, dass sie sich an den ersten besten verkaufen lassen. Freilich spielt die Liebe hier nicht dieselbe Rolle bei der Eheschließung wie bei uns. Das Naturkind kennt keine Romantik. Gewöhnlich werden die Ehen im Familienrat beschlossen. Im Allgemeinen sind sie glücklich.
Die meisten Mädchen heiraten mit fünfzehn Jahren. Fast alle Schülerinnen der Mädchenschule der Mission sind schon einem Manne bestimmt und heiraten, sowie sie aus der Schule entlassen werden.
[…] Die Meinung, dass wir die vorgefundenen Rechte und Sitten veredeln und an dem Bestehenden ohne Not nichts ändern sollen, habe ich mir in Unterhaltungen mit den tüchtigsten und erfahrensten Weißen dieser Gegend gebildet.“Beziehungen zwischen Weißen und Einheimischen
Albert Schweitzer schreibt im Hinblick auf die Beziehungen zwischen Weißen und Einheimischen: „In welcher Art mit dem Farbigen [der einheimischen Bevölkerung] verkehren? Soll ich ihn als gleich, soll ich ihn als unter mir stehend behandeln?
Ich soll ihm zeigen, dass ich die Menschenwürde in jedem Menschen achte. Diese Gesinnung soll er an mir spüren. Aber die Hauptsache ist, dass die Brüderlichkeit geistig vorhanden ist. Wie viel sich davon in den Formeln des täglichen Verkehrs auszudrücken hat, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. Der Neger ist ein Kind. Ohne Autorität ist bei einem Kinde nichts auszurichten. Also muss ich die Verkehrsformel so aufstellen, dass darin meine natürliche Autorität zum Ausdruck kommt. Den Negern gegenüber habe ich dafür das Wort geprägt: »Ich bin dein Bruder; aber dein älterer Bruder.«
Freundlichkeit mit Autorität zu paaren, ist das große Geheimnis des richtigen Verkehrs mit den Eingeborenen. Einer der Missionare, Herr Robert, schied vor einigen Jahren aus dem Verbande der Mission aus, um unter den Negern ganz als Bruder zu leben. Er baute sich ein kleines Haus bei einem Negerdorfe zwischen Lambarene und N’Gômô und wollte als dem Dorf zugehörig betrachtet sein. Von jenem Tage an war sein Leben ein Martyrium. Mit der Aufgabe der Distanz zwischen Weiß und Farbig hatte er den Einfluss verloren. Sein Wort galt nicht mehr als ‚Wort des Weißen‘, sondern er musste mit den Negern über alles lange diskutieren, als wäre er ihresgleichen.
[…] Ich […] komme auf die Tatsache zu sprechen, dass auch die sittlich Tüchtigen und die Idealisten Mühe haben, hier das zu sein, was sie sein wollen. Wir alle verbrauchen uns hier in dem furchtbaren Konflikte zwischen dem europäischen Arbeitsmenschen, der Verantwortungen trägt und nie Zeit hat, und dem Naturkinde, das Verantwortlichkeit nicht kennt und immer Zeit hat. […] In diesem täglichen, stündlichen Konflikt mit dem Naturkind läuft jeder Weiße Gefahr, nach und nach geistig zugrunde zu gehen. […] Dass es hier so schwer ist, sich die reine, humane Persönlichkeit und damit das Vermögen, Kulturträger zu sein, zu wahren, ist die große Tragik des Problem von Weiß und Farbig, wie es sich im Urwalde stellt.“