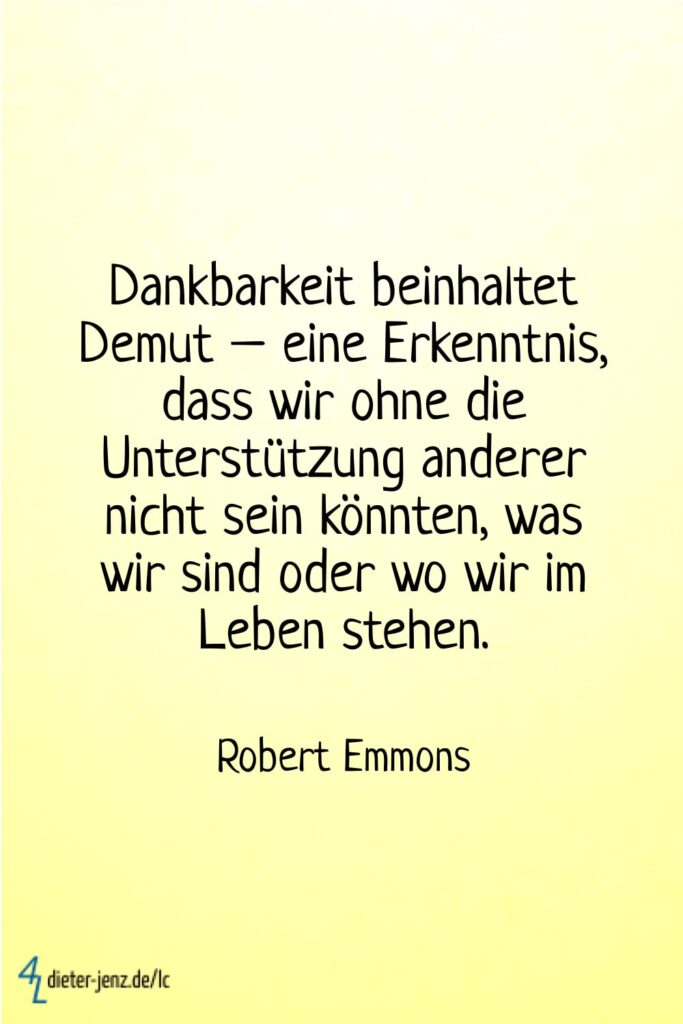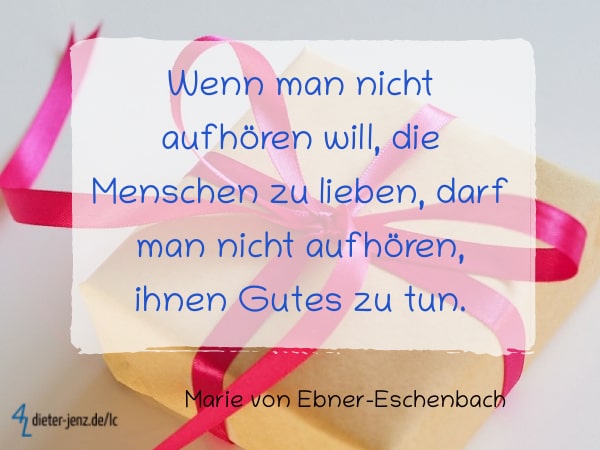Positive Veränderungen erleben – systematisch und nachhaltig. Beharrlichkeit, Ausdauer und Disziplin zahlen sich garantiert aus.
Inhalte:
Positive Veränderungen sind kein Zufall
Als denkende Wesen haben wir Möglichkeit und Macht zu wählen, auf welche Gedanken wir uns konzentrieren und welche Gedanken wir aus unserem Gehirn verbannen wollen. Mit unseren Gedanken können wir, wie bereits erwähnt, unser Gehirn verändern. Zwischen unseren Gedanken und unseren Genen besteht eine Beziehung: wir können unsere Gene beeinflussen.
Das Umwandeln von negativen in positive Gedanken, die unser Selbstwertgefühl stärken und schützen, geschieht im Einklang mit der Arbeitsweise des menschlichen Gehirns. Es verlangt die regelmäßige Wiederholung positiver Gedanken, bis sie zur Gewohnheit werden. Dies geschieht mit einem systematischen und nachhaltigen Prozess, der mehrere 21-Tage-Zyklen umfasst.
Der Umwandlungsprozess muss kontrolliert ausgeführt werden, damit sich der gewünschte und erhoffte Erfolg einstellt: die nachhaltige Verankerung eines positiven Gedankens im Gehirn. Es mag schließlich vorkommen, dass der Prozess nicht so ausgeführt werden kann, wie vorgesehen und erwartet. Was geschieht beispielsweise, wenn man während eines 21-Tage-Zyklus die täglichen Aufgaben einmal vergisst?
In jedem konventionellen Kraftwerk existiert ein Betriebshandbuch das Vorschriften und Empfehlungen zum laufenden Betrieb enthält. Es enthält aber auch mehrere Abschnitte, die sich mit vorbeugender Wartung (regelmäßig geplante Wartungsarbeiten, um unerwartete Probleme und Ausfälle in der Zukunft zu vermeiden), mit kontinuierlicher Überwachung (Monitoring), mit während des Betriebs auftretenden Störungen, mit der Suche von Störungsquellen und der Behebung von Störungen (Troubleshooting), mit der Durchführung von Reparaturen und weiteren einschlägigen Themen beschäftigen.
Für das imaginäre innere Kraftwerk kann, wie bereits erwähnt, kein Betriebshandbuch existieren, denn der Mensch ist keine Bio-Maschine, die man wie eine technische Einrichtung oder ein technisches Gerät pflegen, warten und reparieren könnte. Für das innere Kraftwerk musste es im übertragenen Sinne selbst geschrieben werden.
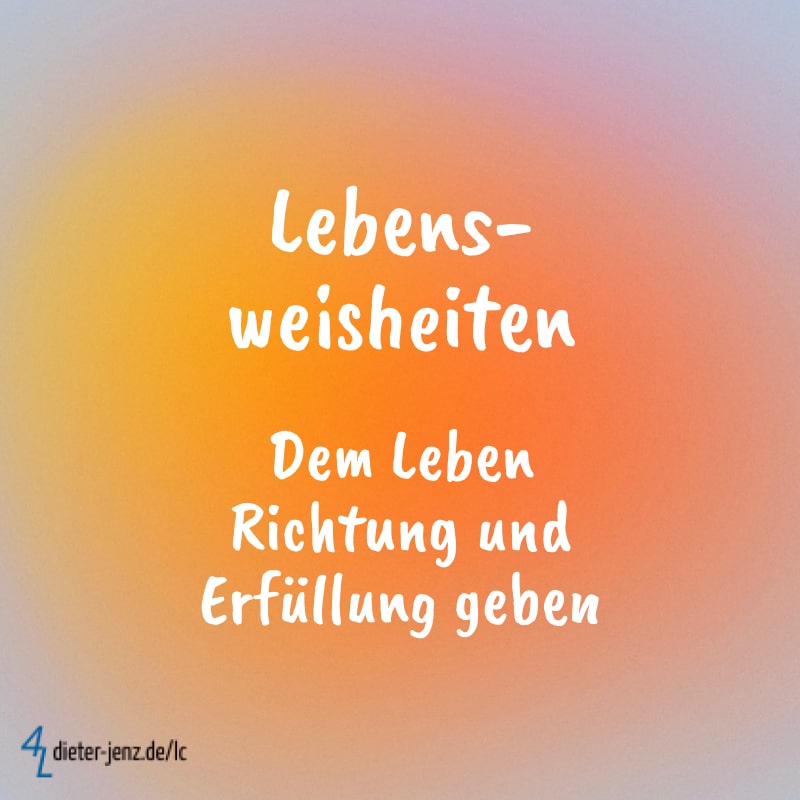

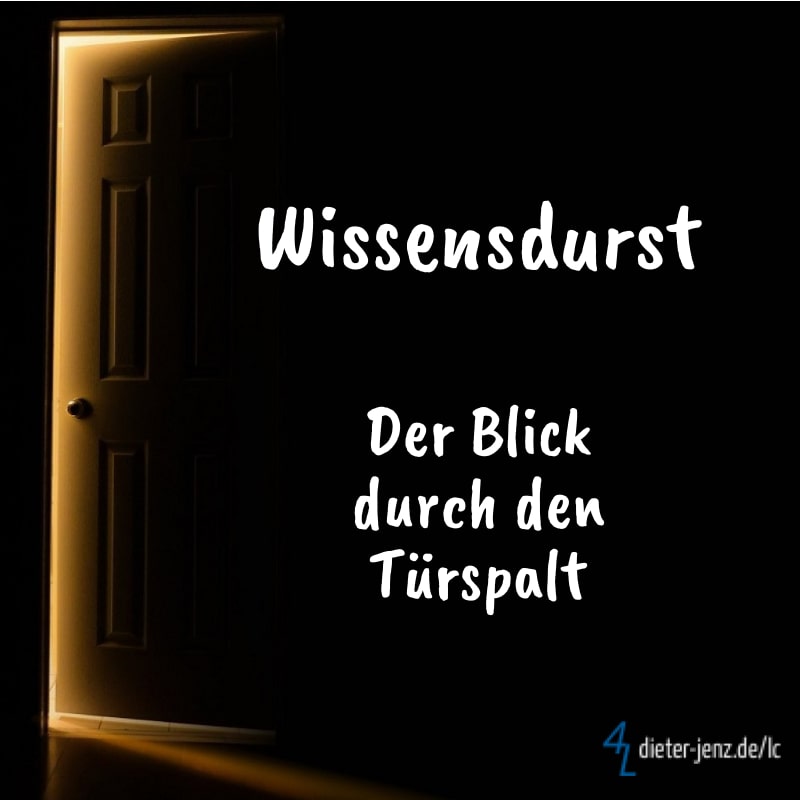
Vorhersehbarkeit von Ereignissen
Während der mehrjährigen Nutzungsdauer eines konventionellen Kraftwerks kann es zu vorhergesehenen (z. B. geplante Wartungsarbeiten) und unvorhergesehenen Ereignissen (z. B. Störfälle) kommen. Sofern es zu einer geplanten Abschaltung oder zu einem ungeplanten Ausfall kommt, muss die Stillstandzeit so kurz wie nur möglich gehalten werden.
Sinngemäß kann es auch beim imaginären inneren Kraftwerk zu vorhersehbaren „Ruhezeiten“ (während des Schlafs) und zu unvorhersehbaren Störfällen kommen. Hier stößt die Analogie an ihre Grenzen, denn das menschliche Gehirn kennt, abgesehen vom Zustand der Bewusstlosigkeit keine sinngemäße „Stillstandzeit“.
Vorhersehbare Ereignisse
In einem konventionellen Kraftwerk werden in regelmäßigen Zeitabständen Wartungsarbeiten ausgeführt. Es kann erforderlich werden, dass das Kraftwerk zu diesem Zweck vorübergehend abgeschaltet werden muss. Es wird heruntergefahren und nach Abschluss der Wartungsarbeiten wieder hochgefahren.
Das menschliche Gehirn kann natürlich nicht hoch- und heruntergefahren werden. Es ist grundsätzlich immer aktiv und arbeitet auch während einer Schlafphase. Mit dem Aufwachen wird das Gehirn gewissermaßen – und bildlich ausgedrückt – aus einer Art „Standby-Modus“ in den „Aktiv-Modus“ versetzt. Jetzt nehmen wir mit den fünf Sinnen bewusst wahr, reagieren auf die Umwelt, treffen Entscheidungen usw. Mit dem Einschlafen wird das Gehirn wieder in eine Art „Standby-Modus“ versetzt. Auf äußere Reize reagieren wir nur noch mehr oder weniger vermindert oder verzögert.
Nicht vorhersehbare Ereignisse
Dank einer Vielzahl verbauter Sensoren kann in einem konventionellen Kraftwerk ein unvorhergesehenes Problem schnell erkannt werden. Wenn es zu einem Störungsereignis kommt, (z. B. ein plötzlicher Druckverlust in einer Leitung), wird dies über ein entsprechendes Signal an den Leitstand gemeldet. Ein Operator muss dann gemäß dem dafür im Betriebshandbuch vorgesehenen Verfahren handeln.
Auch im menschlichen Körper existieren im übertragenen Sinne Sensoren. Hat man beispielsweise verdorbenen Fisch gegessen, kommt es in der Regel zu krampfartigen Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und manchmal auch Durchfall. Der Körper entledigt sich automatisch der unverträglichen Speisen. Der Brechreiz als Gefühl, alles herauswürgen zu müssen, entsteht im sogenannten Brechzentrum im Gehirn.
Im Hinblick auf die Psyche gibt es keinen Automatismus. Wenn es zu einem unvorhergesehenen Störungsereignis kommt, welches das Selbstwertgefühl angreift (z. B. durch eine als demütigend empfundene Kritik im Beisein anderer), kann die Psyche sich nicht einfach automatisch dieser für das Wohl der Psyche „unverträglichen“ Kränkung entledigen. In der Konsequenz dürfen derartige Störungsereignisse nicht leichtfertig verdrängt oder gar ignoriert werden. Sie müssen, bildlich ausgedrückt, an den Leitstand des inneren Kraftwerks gemeldet werden, damit auf das Störungsereignis in geeigneter Art und Weise reagiert werden kann.
Wahrscheinliche Ereignisse
Bei manchen Ereignissen ist zumindest damit zu rechnen, dass sie irgendwann eintreten. Im Hinblick auf die Aufgaben im 21-Tage-Zyklus kann es zu einem Motivationstief kommen. Es fehlt der Antrieb, die für den Tag vorgesehenen Aufgaben ganz oder teilweise auszuführen.
Um einen neuen Gedanken nachhaltig zu verankern ist Kontinuität erforderlich. Deshalb ist Disziplin erforderlich, um zeitliche Unterbrechungen zu vermeiden. Mit anderen Worten: Auch wenn einmal die Motivation fehlt, ist es notwendig, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden und vorgesehenen Aufgaben auszuführen.
Überwachen (Monitoring)
Das Überwachen verfolgt zwei Zwecke: zum einen soll sichergestellt werden, dass alle geplanten Aufgaben des Tages wie vorgesehen ausgeführt werden. Zum anderen sollen Versäumnisse und unvorhersehbare Störungsereignisse schnell erkannt werden, um in geeigneter Art und Weise darauf reagieren zu können.
Routineaktivitäten
„Hast du alle Hausaufgaben gemacht?“, an diese Frage der Mutter oder des Vaters, meist am späten Nachmittag gestellt, erinnern sich viele Menschen. Diese Erinnerung an die Schulzeit ruft wieder ins Gedächtnis, dass diese Frage zuweilen durchaus wichtig war. Es konnte ja vorkommen, dass man mit anderen Dingen so intensiv beschäftigt war, dass man überhaupt nicht mehr an seine Hausaufgaben dachte. Durch die rechtzeitige Erinnerung konnten die Hausaufgaben noch erledigt werden.
Wenn eine Aufgabe über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig ausgeführt wird, beispielsweise das abendliche Zähneputzen, stellt sich eine Verhaltensgewohnheit ein. Weil man schon seit Jahren abends die Zähne putzt, bedarf es keiner besonderen Erinnerung mehr. Anders verhält es sich, wenn eine Handlung noch nicht „in Fleisch und Blut übergegangen“ ist. Die Aufgaben im Rahmen eines 21-Tage-Zyklus zählen zu dieser Kategorie. Dann ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass nichts vergessen wird.
Wer kennt sie nicht – die Checklisten? Checklisten als Prüflisten mit abzuhakenden Aktivitäten haben sich als probates Mittel erwiesen, um festzustellen, ob regelmäßig durchzuführende Aktivitäten erledigt wurden. Die folgende musterhafte Checkliste umfasst alle Aktivitäten der Kontrollroutine.
| Erledigt | Routine | Auszuführen | Zu kontrollieren |
| □ | Morgenroutine | Direkt nach dem Aufwachen | <…> Min. nach Erinnerung |
| □ | Ausführungsroutine | <zur individuell passenden Zeit> | <…> Min. nach Erinnerung |
| □ | Abendroutine | Rechtzeitig vor dem Einschlafen | entfällt |
In der Erinnerungsroutine wurden Zeiten eingestellt. Die Überprüfung erfolgt zeitlich etwas später, um genügend Zeit zu lassen, falls die Routineaktivitäten vergessen wurden. Die Zeitabstände werden individuell festgelegt.
Morgen- und Abendroutine sind optional, werden jedoch empfohlen. Bei Verzicht auf eine oder beide dieser Routinen verkürzt sich diese kurze Checkliste nochmals.
Mit einer systematischen Kontrolle demonstriert man sich selbst gegenüber, dass man es sich selbst wert ist, seine kostbare Zeit für seine täglichen Aufgaben einzusetzen.
Versäumnisse
Ein Versäumnis liegt vor, wenn man eine geplante Aufgabe entweder überhaupt nicht oder nicht wie vorgesehen ausführt. Es mag vorkommen, dass man für die täglichen Aufgaben nicht die notwendige Zeit findet, weil etwas besonders Wichtiges alle Zeit erfordert. Möglicherweise verhindert eine Erkrankung oder ein sonstiges Ereignis (z. B. ein Unfall) die Ausführung der Aufgaben. Vielleicht vergisst man sie auch einfach.
Der 21-Tage-Zyklus erfordert zwingend, dass an jedem Tag Aufgaben ausgeführt werden müssen. Geschieht die nicht, wird der Prozess unterbrochen. Als Konsequenz daraus werden auch die Veränderungsprozesse im Gehirn unterbrochen. Deshalb ist es notwendig, den 21-Tage-Zyklus wieder neu zu beginnen.
Es ist keineswegs schlimm, wenn der Umwandlungsprozess unterbrochen wird. Man darf nachsichtig mit sich selbst sein. Wenn der 21-Tage-Zyklus wieder neu begonnen wird, geht schließlich nichts verloren. Bildlich ausgedrückt, wird ein Signal an den Leitstand des imaginären inneren Kraftwerks gesendet, das auf die notwendige Wiederholung aufmerksam macht.
Störungsereignisse
Während man daran arbeitet, sein Selbstwertgefühl zu stärken, geht das normale Leben weiter. Man ist in das soziale Gefüge eingebunden, wirkt einerseits auf seine Mitmenschen, erlebt andererseits auch das Wirken der Mitmenschen auf sich.
Dieses alltägliche Einwirken der Mitmenschen kann zu diversen Störungsereignissen führen, die die eigene Integrität angreifen und verletzen können. Beispielhaft genannt sei das versuchte Vereinnahmen, um beispielsweise dazu zu bewegen, gegen einen Mitmenschen Partei zu ergreifen.
Im Hinblick auf das Selbstwertgefühl ist die Selbstwertkränkung das primäre Störungsereignis. Eine Selbstwertkränkung bezeichnet die tatsächliche oder vermeintliche Verletzung eines Menschen in seiner Selbstachtung. Eine derartige Selbstwertkränkung kann sowohl unbeabsichtigt als auch mit Absicht erfolgen.
Auch hier wird ein Signal an den Leitstand des imaginären inneren Kraftwerks gesendet. Es macht darauf aufmerksam, dass darüber nachgedacht werden muss, wie mit dem Störungsereignis umzugehen ist.
Beabsichtigte Selbstwertkränkung durch andere
Erfolgt die Selbstwertkränkung beabsichtigt, zielt sie bewusst darauf ab, Selbstsicherheit, Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstwert des anderen zu erschüttern und zu schwächen. Bloßstellung, Demütigung, Herabwürdigung, Erniedrigung, Entwertung oder Spott sind häufig eingesetzte Mittel. Wenig verwunderlich löst dies bei der gekränkten Person Gefühle, wie beispielsweise Angst, Scham oder auch Wut aus. In der Konsequenz kann auch der Wunsch nach Rache geweckt werden.
Unbeabsichtigte Selbstwertkränkung durch andere
Viele Selbstwertkränkungen durch andere geschehen ohne bewusste Absicht zu kränken. Die Selbstwertkränkung ist oft eine unbeabsichtigte Folge, wenn eine Person für sich selbst sorgt. Typisches Beispiel ist die Trennung einer Beziehung. Die Person, die sich trennt, sieht in der Beziehung keine Zukunft mehr und entscheidet sich in der Konsequenz dafür, diese – hoffentlich – im gemeinsamen Gespräch zu beenden. Die von der Trennung betroffene Person sieht die Perspektive für die Beziehung jedoch möglicherweise völlig anders und erlebt die Trennung deshalb als gegen ihren Wunsch und Willen gerichtet. Die empfundene Zurückweisung ist mit einer Selbstwertkränkung verknüpft. „Ich genüge ihm/ihr nicht, denn sonst würde ich ja nicht zurückgewiesen werden“ ist ein naheliegender Gedanke. Auch Liebeskummer ist eine Selbstwertkränkung.
Ein weiteres Beispiel, allerdings in einem gewissen Graubereich, ist das abrupte Ende einer zwischenmenschlichen Beziehung durch eine Person ohne Vorwarnung oder Erklärung dafür. Dies, auch als Ghosting bezeichnet, löst bei der betroffenen Person fast immer eine Selbstwertkränkung aus. Sie fühlt sich zurückgewiesen, zurückgestoßen, herabgewürdigt. Situationsspezifisch mag sich die Frage stellen, ob die Selbstwertkränkung tatsächlich unbeabsichtigt geschieht. Dies wird eher zu vermuten sein, wenn der „Ghoster“ ein massives Bindungsproblem hat und die betroffene Person gewissermaßen austauschbar ist. Er macht sich einfach keine Gedanken darüber, was er bei der betroffenen Person anrichtet.
Auch ein Verlust des Arbeitsplatzes, beispielsweise durch eine betriebsbedingte Kündigung, kann zu einer Selbstwertkränkung führen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Person für sich nur geringe Chancen sieht, wieder einen geeigneten Job zu finden. „Ich bin zu alt“ oder „Ich bin zu nichts mehr nütze“, sind typische mit einer Selbstwertkränkung verknüpfte Gedanken.
Positive Veränderungen wirken sich spürbar aus
Der 21-Tage-Zyklus verlangt zweifellos Beharrlichkeit, Ausdauer und Disziplin. Doch es lohnt sich ungemein. Ein abgeschlossener 21-Tage-Zyklus endet garantiert mit einem Fortschritt. Gleichwohl ist noch zu bewerten, ob sich der neue Gedanke bereits tief genug eingeprägt hat. Falls nicht, ist ein weiterer Zyklus angeraten.
Das gestärkte Selbstwertgefühl strahlt unweigerlich auf das Umfeld aus. Mitmenschen nehmen es wahr. Und man nimmt es selbst auch wahr, freut sich darüber und genießt die Früchte.