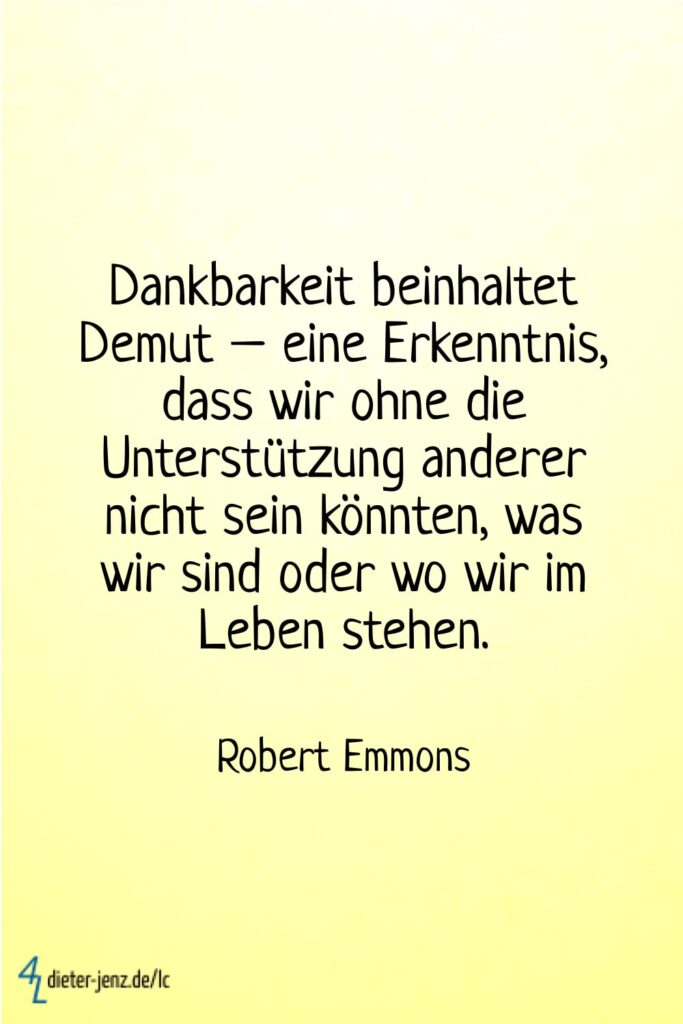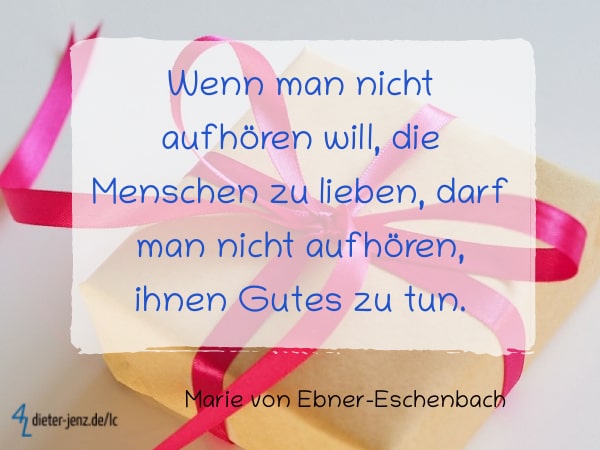Zyklus starten – mit klarem Ziel im Auge, motiviert, entschlossen und mit Freude. Ein 21-Tage-Zyklus beginnt. Während dieser 21 Tage wird das Gehirn, bildlich ausgedrückt, „umverdrahtet“.
Inhalte:
Zyklenmodell der F3S-Methode
Mit der F3S-Methode wird, wie bereits erwähnt, das Ziel verfolgt, selbstwertschwächende, toxische Gedanken durch selbstwertstärkende, positive Gedanken nachhaltig zu „ersetzen“. In einer Abfolge von 21-Tage-Zyklen entsteht eine neue Denkgewohnheit. Bildlich ausgedrückt, wird das Flussbett des toxischen Gedankens zugeschüttet und für den positiven Gedanken ein Flussbett eingegraben.
Die Vorgehensweise führt zum Erfolg, denn sie macht sich die Erkenntnisse der Hirnforschung zunutze. Ein wesentliches Element dieser Methode ist, wie ebenfalls bereits erwähnt, die konsequente und disziplinierte tägliche Ausführung einiger weniger Schritte. Auf diese Weise wird eine Gewohnheit verankert.
Parallelen lassen sich auch im Hinblick auf andere Ziele erkennen, die mit Konsequenz und Disziplin verfolgt werden. Wer beispielsweise Gewicht verlieren möchte, muss konsequent und diszipliniert über einen längeren Zeitraum hinweg auf eine negative Kalorienbilanz achten. Mit anderen Worten: während eines bestimmten Zeitraums muss mehr Energie verbraucht werden als über die Nahrung aufgenommen wird. Oder wer beispielsweise Muskelmasse hinzugewinnen möchte, muss über einen längeren Zeitraum hinweg konsequent und diszipliniert auf geeignete Weise trainieren. Über längere Zeit hinweg stellt sich aufgrund physiologischer Gesetzmäßigkeiten garantiert ein Erfolg ein.
Damit eine nachhaltige „Umverdrahtung“ des Gehirns erreicht wird, sind mehrere 21-Tage-Zyklen erforderlich. Der erste 21-Tage-Zyklus unterscheidet sich von allen folgenden, denn im ersten Zyklus werden wichtige Festlegungen getroffen, die dann für alle weiteren Zyklen maßgeblich sind.
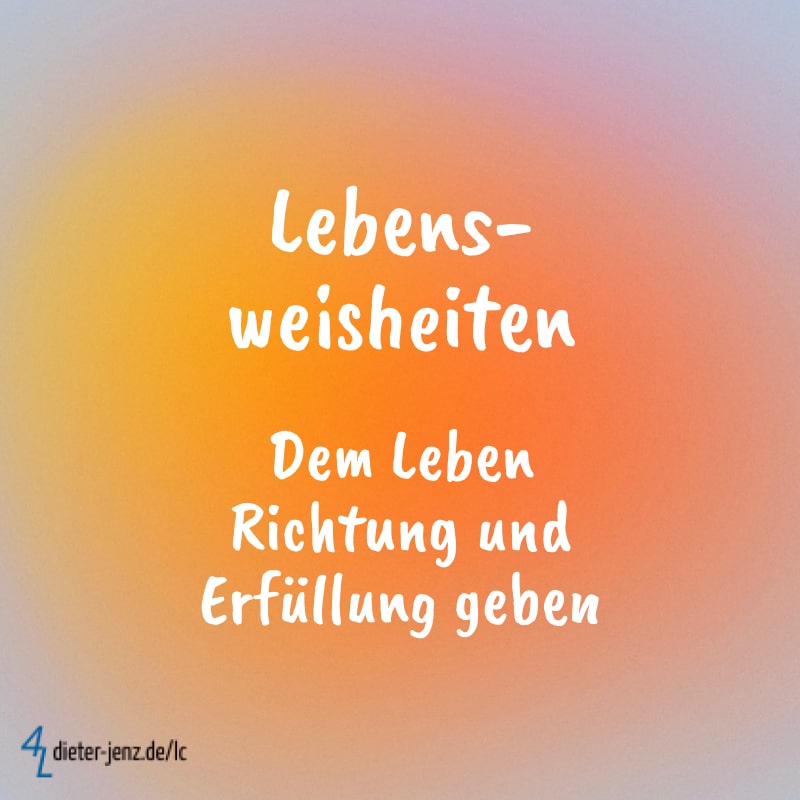

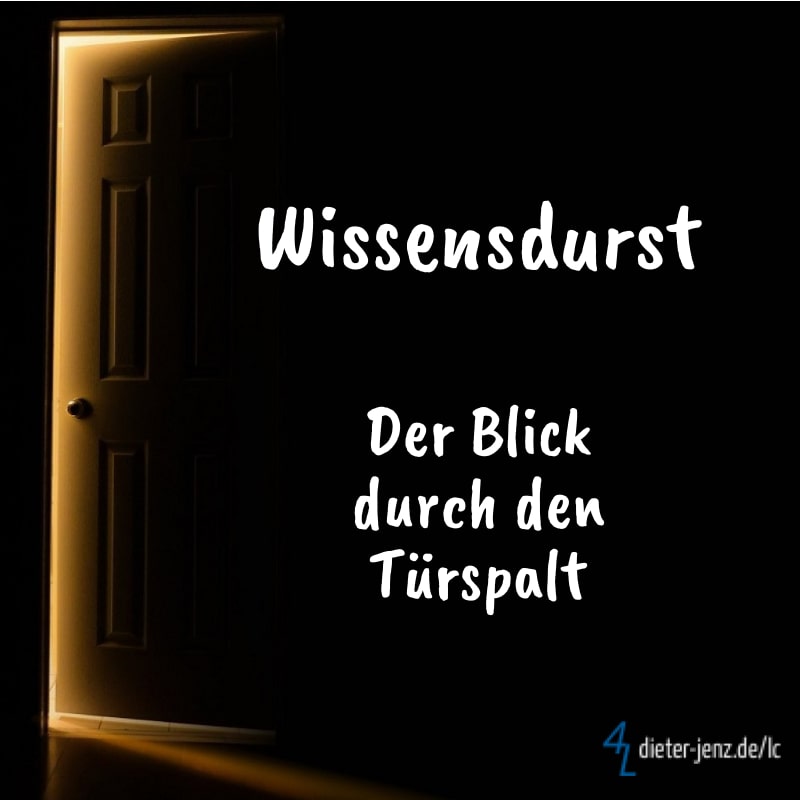
Erster 21-Tage-Zyklus
Der erste Zyklus konzentriert sich auf die Auswahl des toxischen Gedankens, dem ein positiver Gedanke gegenübergestellt werden soll. Diese Wahl bleibt auch für die folgenden Zyklen bestehen. Des Weiteren ist zu klären, ob Motivation und Entschlossenheit vorhanden sind, um das gewünschte Ziel auch zu erreichen.
Auswahl des selbstwertschwächenden Gedankens
Wie lauten die zu einer Denkgewohnheit gewordenen Gedanken, die für das Selbstwertgefühl schädlich sind und es schwächen? Diese Frage lässt sich oft nicht so leicht beantworten wie es auf den ersten Blick scheint. Um zu einer Antwort zu gelangen, lohnt sich ein vertiefter Blick auf selbstwertschwächende musterhafte Aussagen und Gewohnheiten. Mögliche Quellen sind vor allem:
- Der Selbstwert-Test,
- Selbstwertschwächende Glaubenssätze,
- Selbstwertschwächende Gewohnheiten und Einstellungen.
Während des Nachdenkens über musterhafte Aussagen und Gewohnheiten machen sich Gefühle bemerkbar. Wenn man wahrnimmt, dass man gefühlsmäßig intensiv oder sogar besonders intensiv reagiert, sollte die jeweilige Aussage, Gewohnheit oder Einstellung schriftlich festgehalten werden. Am besten wird sie gleich so umformuliert, dass sie als selbstwertschwächender Gedanke genau zur persönlichen Situation passt.
Es ist keineswegs ungewöhnlich, wenn mehrere selbstwertschwächende Gedanken notiert werden. Zunächst steht das Sammeln im Vordergrund. Die Endauswahl erfolgt später.
Die folgenden Inhalte befinden sich im Buch:
- Der Selbstwert-Test
- Selbstwertschwächende Glaubenssätze
- Selbstwertschwächende Gewohnheiten und Einstellungen
Priorisierung und Entscheidung
Wahrscheinlich wurden mehrere selbstwertschwächende Gedanken schriftlich festgehalten. Vielleicht ist die Liste sogar richtig lang geworden. Jedenfalls wäre es nicht verwunderlich.
Im nächsten Schritt wird jeder dieser Gedanken gewissermaßen im Herzen bewegt. Das Herz wird schon seit der Antike als der Sitz des Gefühls betrachtet. Für den griechischen Universalgelehrten Aristoteles (384-322 v. Chr.) war das Herz sogar der Sitz der Seele. Natürlich wissen wir schon lange, dass Gedanken und Gefühle im Gehirn entstehen. Das „im Herzen bewegen“ drückt aber aus, dass nicht das vernunftgeleitete, zweckgerichtete Denken im Mittelpunkt steht.
Selbstwertschwächende Gedanken werden am besten nach der Intensität der damit verbundenen Gefühle geordnet. Jedem dieser Gedanken wird eine Priorität (z. B. „hoch“, „mittel“, „gering“) zugewiesen. Falls mehreren Gedanken eine hohe Priorität zugewiesen wurde, wird einer davon ausgewählt und die Entscheidung dafür getroffen. Die weiteren Gedanken bleiben Kandidaten für spätere erste 21-Tage-Zyklen.
Der Prozess der Priorisierung, Auswahl und Entscheidung benötigt seine Zeit. Es soll etwas geklärt werden. Damit etwas geklärt werden kann, muss es ans Licht kommen und auch akzeptiert werden. Dieses Akzeptieren kann durchaus mit psychischem Schmerz verbunden sein. Angenommen, man hat erkannt, dass man sich durch das „sich-vergleichen“ mit anderen selbst klein gemacht hat. Der psychische Schmerz kann beispielsweise in der Erkenntnis bestehen, dass man dadurch im Leben schon viel verpasst hat und unter seinen Möglichkeiten geblieben ist.
Vor diesem Hintergrund wäre es kontraproduktiv, sich zeitlich unter Druck zu setzen. Selbst wenn es sich um Stunden handelte – es lohnt sich! Denn was ans Licht kommt, wird seine schädliche, vielleicht sogar zerstörerische Macht verlieren. In einem 21-Tage-Zyklus wird zielgerichtet und konsequent daran gearbeitet, diese Macht zu nehmen.
Auswahl des selbstwertstärkenden Gedankens
Dem selbstwertschwächenden, toxischen Gedanken wird ein selbstwertstärkender, positiver Gedanke gegenübergestellt. Der toxische Gedanke darf keinesfalls ohne Gegenpol bleiben.
Vor Beginn des ersten 21-Tage-Zyklus sollte man sich die erforderliche Zeit nehmen, um den positiven Gedanken zu formulieren und daran zu „feilen“. Vielleicht erschließt sich der positive Gedanke sofort und erscheint schlüssig. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Zeit benötigt wird, um den positiven Gedanken auszuformulieren. Schließlich muss er zur individuellen Vorstellung, wie es letztendlich sein soll, exakt passen.
Wenn man beispielsweise eine Urlaubsreise plant, entwickelt man in seiner Vorstellung ein Bild. Dieses lebhafte Bild umfasst vielerlei Aspekte, so u. a. wie es am Urlaubsziel aussieht, was man dort alles unternehmen und erleben könnte, oder wie es sich anfühlt, wenn man am Strand entlang geht und den Sand an den Fußsohlen spürt.
Auch zum positiven Gedanken kann man ein lebhaftes Bild entwickeln. Angenommen, der selbstwertstärkende Gedanke lautet „Ich bin bedingungslos wertvoll!“. Dazu würde die Vorstellung eines Diamanten passen. Ein Diamant steht für Werthaltigkeit. In der Vorstellung könnte man sich im übertragenen Sinne selbst als Diamant betrachten. Man hält diesen Diamanten zwischen seinen Fingern, betrachtet ihn ausgiebig und freut sich.
Diese Vorstellung passt auch zum Gedanken sozialer Wertigkeit und Bedeutung. Jeder Mensch besitzt soziale Wertigkeit und Bedeutung. Es ist nicht egal, ob ein Mensch auf der Welt ist oder nicht. Jeder Mensch kann in seinem Umfeld Positives bewirken und in übertragenem Sinne die Welt verändern. Es müssen keine Großtaten sein. Schon kleinste Zeichen, beispielsweise ein Lächeln, wirken weltverändernd.
Um sicherzugehen, dass der selbstwertstärkende Gedanke auch wirklich genau passt, sollte er daraufhin geprüft werden. Folgende Fragen sind dabei hilfreich:
- „Ist es mein Gedanke oder habe ich den Gedanken von jemand anderem übernommen?“,
- „Kann ich mich mit dem positiven Gedanken vorbehaltlos identifizieren?“,
- „Löst der Gedanke bei mir ein Gefühl der Freude aus, wenn ich daran denke, dass der positive Gedanke zur Gewohnheit geworden ist?“,
Wenn man sicher ist, dass der selbstwertstärkende Gedanke genau passt, sollte er schriftlich festgehalten werden. Dieser Gedanke wird die nächsten Wochen und Monate bestimmen, so lange bis er sich zur Denkgewohnheit entwickelt hat.
Klärung von Motivation und Entschlossenheit
Vor Beginn eines 21-Tage-Zyklus ist es sinnvoll, sich hinsichtlich Motivation und Entschlossenheit zur Veränderung klar zu werden. Wenn es an Entschlossenheit mangelt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ein Zyklus nicht zum Ende gebracht wird und sich in der Konsequenz der erwartete Erfolg nicht einstellt.
Motivation
Um für sich selbst herauszufinden, wie es um die eigene Motivation zur Veränderung bestellt ist, empfiehlt es sich, in die Zukunft zu denken. Wie wird es in fünf Jahren sein, wenn sich nichts ändert? Die konkrete Frage könnte lauten: „Wie glücklich bin ich in fünf Jahren, wenn ich so weitermache wie jetzt, wenn sich nichts ändert?“
Bei der Beantwortung dieser Frage erschrickt man vielleicht und sagt sich: „Wenn ich mir das so vorstelle, will ich keinesfalls so weitermachen wie bisher.“ Lautet die Antwort so, ist sicherlich eine hinreichende Motivation gegeben. Lautet sie demgegenüber: „Ach ja, ich bin ja sowieso nur ein Spielball. Was soll sich schon ändern?“, fehlt die Motivation.
Entschlossenheit
Sehr wahrscheinlich wird die Entschlossenheit während eines Zyklus auf die Probe gestellt. Es kann zu einem „Durchhänger“ kommen. Es mag aber auch sein, dass, durch welche Umstände auch immer, der Selbstwert gekränkt wird. Vielleicht ist es eine abwertende Bemerkung einer Kollegin oder eines Kollegen, die Kritik des Vorgesetzten oder man fühlt sich von einer Freundin oder einem Freund zurückgewiesen. Was immer es auch sei – die Entschlossenheit kann einen Dämpfer erleiden.
Es ist durchaus nicht ungewöhnlich, dass es zu einem „Durchhänger“ kommt. Dann stellt sich die Frage, ob die täglich anstehenden Aufgaben trotzdem angegangen werden, auch wenn es an Lust dazu fehlt.
Auch Spitzensportler, als Beispiel, haben ihre „schlechten“ Tage, an denen ihre Entschlossenheit auf die Probe gestellt wird. Doch sie wissen, dass sie das angestrebte große Ziel nicht erreichen werden, wenn sie ihr Training vernachlässigen. Also absolvieren sie beharrlich ihr Trainingspensum, auch wenn sie gerade keine Lust dazu haben.
Aus der Ich-Perspektive formuliert kann man zu sich selbst sagen: „Ich muss damit rechnen, dass ich einen ‚Durchhänger‘ habe. Wenn es so kommen sollte, will ich mich trotzdem nicht von meinem Ziel abbringen lassen und weitermachen.“
Weiterer 21-Tage-Zyklus
Bis sich ein selbstwertstärkender Gedanke zu einer Denkgewohnheit entwickelt hat, sind mehrere 21-Tage-Zyklen erforderlich. Wie viele letzten Endes benötigt werden, lässt sich frühestens nach dem Ende des zweiten Zyklus erkennen.
Jeder Folgezyklus schließt sich nahtlos an den vorhergehenden Zyklus an. Bei Beginn eines neuen Zyklus empfiehlt es sich, Motivation und Entschlossenheit aufzufrischen, etwa so: „Ich bin nach wie vor motiviert. Ich bin weiterhin fest entschlossen, an mir zu arbeiten und eine neue Denkgewohnheit zu entwickeln. Ich bin es mir wert!“
Um sich den Beginn eines neuen Zyklus bewusst zu machen, ist auch eine bildliche Vorstellung hilfreich. Das Bild des Startschusses bietet sich dafür an.
Freude am Fortschritt wahrnehmen
Jeder Mensch ist Gestalter seines Lebens und hat Gestaltungsmacht über sich. Dies schließt natürlich die Fähigkeit zur „Umverdrahtung“ des Gehirns mit ein. Aus der Ich-Perspektive formuliert: „Ich habe es selbst in der Hand, ob und wie ich mein Gehirn ‚umverdrahte‘. Niemand kann mich daran hindern, nur ich selbst.“
Freude spielt in der menschlichen Gefühlswelt eine sehr wichtige Rolle. Sie hat mehrere biologisch bedeutsame Wirkungen auf den Menschen. Positive Gefühle wie Freude oder gar Begeisterung verstärken unsere Energie und auch das Vertrauen in unsere Handlungsfähigkeit. Umgekehrt löst die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, d. h. die Erfahrung, eigene Fähigkeiten und Kompetenzen wirksam einsetzen zu können, Freude aus.
Am Beginn eines neuen 21-Tage-Zyklus steht auch die Freude darauf, am Ende eines 21-Tage-Zyklus einen Fortschritt zu erkennen. „Es hat sich etwas verändert, weil ich es will, und darüber freue ich mich.“