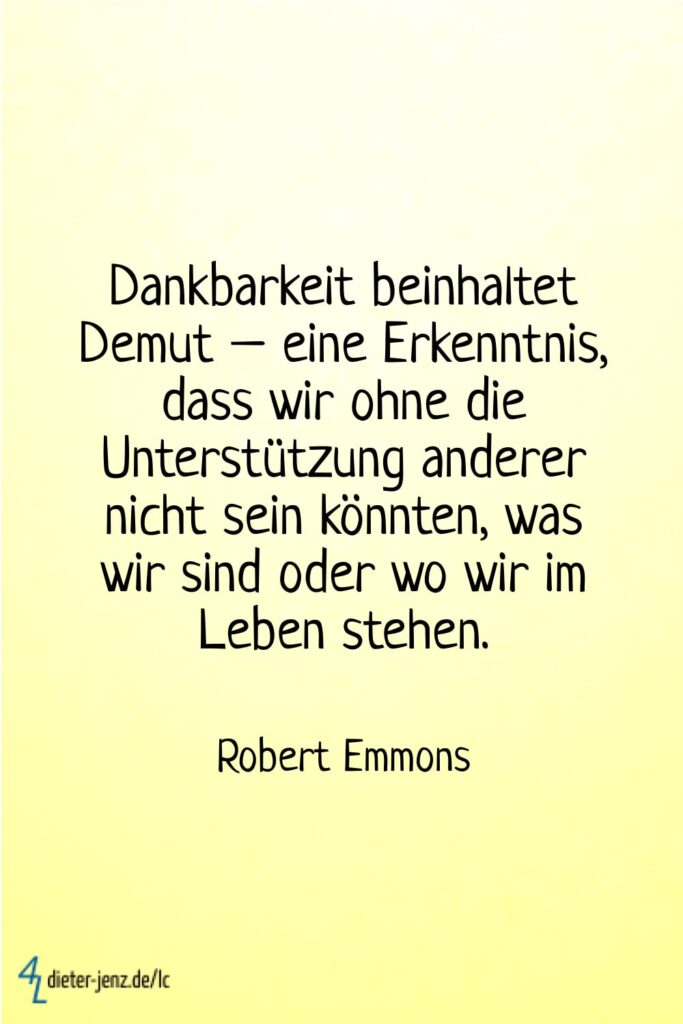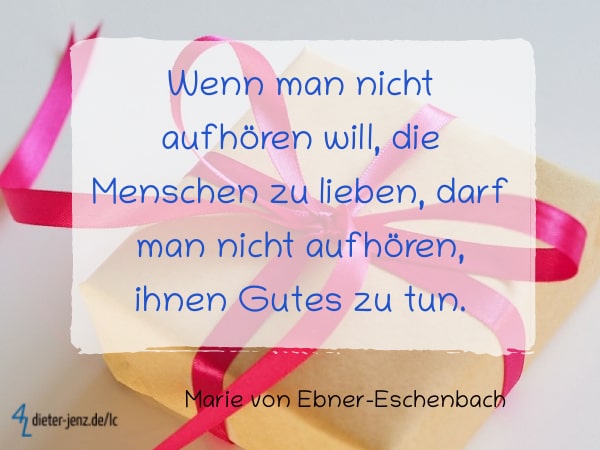Macht entziehen – dem inneren Kritiker. Wie kann man es schaffen, den inneren Kritiker zu entmachten? Welche praktische Möglichkeit gibt es?
Inhalte:
Der misslungene Vortrag
Markus (Name geändert) hatte bei einer wichtigen geschäftlichen Besprechung einen kurzen Vortrag zu halten. Leider kam sein Vortrag nicht gut an. Die anderen Besprechungsteilnehmer waren unzufrieden, einige davon sogar sehr, und gaben nicht nur ihm direkt entsprechende Rückmeldungen, sondern äußerten sie in versammelter Runde. Markus war verständlicherweise sehr enttäuscht, mit sich selbst unzufrieden, und fühlte sich als Versager.
Ein misslungener Vortrag konnte für seine berufliche Entwicklung natürlich nur hinderlich sein. In seiner ersten Reaktion bezog Markus die Kritik auf sich selbst und nicht auf die Sache, seinen Vortrag. Dabei meinten die negativ kritischen Teilnehmer überhaupt nicht ihn als Person, sondern es war der Vortrag, der ihren Erwartungen nicht genügte. Die Bezugspunkte unterschieden sich: hier Person, dort Sache. Indem Markus die Kritik zunächst einmal ungefiltert auf sich bezog, geriet er auf eine Spur, auf der er sich zum Versager stempelte, sich selbst abwertete und sich letzten Endes selbst schadete.
Dass sich Markus selbst in die Reihe der Kritiker einreihte ist nichts Ungewöhnliches. Jeder Mensch hat einen inneren Kritiker. Er gehört gewissermaßen zur psychischen Grundausstattung dazu.
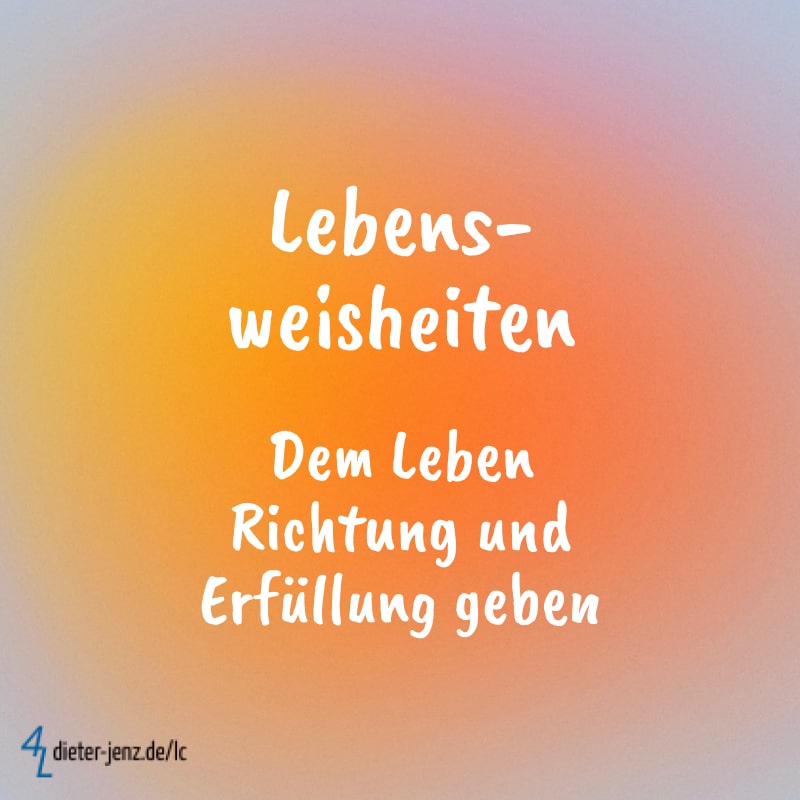

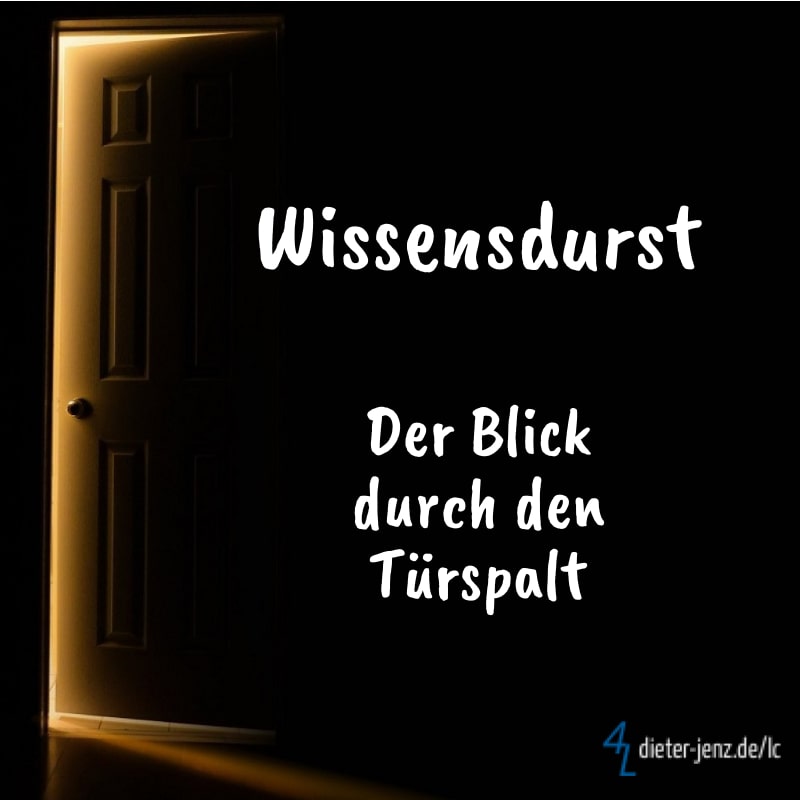
Wer genau ist der innere Kritiker?
Der innere Kritiker ist eine imaginäre Person, die sich über negative Gedanken mitteilt. Manchmal wird auch das Bild einer inneren Stimme verwendet. Der innere Kritiker betont das Negative und lenkt die innere Aufmerksamkeit darauf. Er neigt – unter anderem – zu negativen Pauschalurteilen und stellt Pauschalforderungen, beispielsweise:
- „Du kannst aber auch gar nichts!“,
- „Du darfst keine Schwäche zeigen!“,
- „Du bist einfach nur blöd!“.
Unweigerlich stellt sich die Frage, wann der innere Kritiker gewissermaßen geboren wird und sich in das Leben einschaltet. Wann beginnt er mit seinem Wirken?
Gewissermaßen „heimlich, still und leise“ wird der innere Kritiker zum Lebensbegleiter, und zwar schon in der frühen Kindheit. Die engsten Bezugspersonen, insbesondere die Eltern, vermitteln einen moralischen Kompass. Sie geben vor, was gut oder schlecht ist, was erstrebenswert ist und was nicht, was erlaubt oder verboten ist, welches Verhalten erwünscht oder unerwünscht ist, usw.
Kinder haben das natürliche Bedürfnis, geliebt zu werden. Ermahnungen oder auch Strafen werden je nach Intensität als unangenehm oder auch als schmerzhaft empfunden. Um ihren Bezugspersonen einen Grund zu geben, sie zu lieben, entwickeln Kinder ein Vermeidungsverhalten, indem sie sich innerlich in ihren Gedanken selbst ermahnen. Dies wird unbewusst als Weg gesehen, Ermahnung und Strafe zu vermeiden.
Im Lauf der Entwicklung wächst die Zahl der Personen, die einen im weitesten Sinne lieben, aber auch ermahnen oder strafen könnten. Schulkameraden, Bekannte, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und Vorgesetzte stehen stellvertretend für Personen, die das eigene Leben auf die ein oder andere Weise beeinflussen. Deshalb „wächst“ auch der innere Kritiker in gewisser Weise mit. Will man es anderen Menschen immer recht machen, wird sich der innere Kritiker nachvollziehbarerweise häufig melden.
Wie meldet sich der innere Kritiker?
Unglücklicherweise steht dem inneren Kritiker eine ganze Palette von Möglichkeiten zur Verfügung, um mit schädlichen bzw. toxischen Gedanken das Leben zu erschweren. Seine wichtigsten Ansatzpunkte sind:
- Pauschalisierung (bereits genannt): der Einzelfall wird auf das Ganze übertragen. Beispiel: „Ich bin echt zu doof für alles!“
- Perfektionismus: die Erwartungen an sich selbst werden sehr hoch angesetzt. Beispiel: „Die Präsentation muss perfekt sein.“
- Negative Übertreibung: wenn etwas nicht gelingt oder ein Ereignis bevorsteht, das Unsicherheit einflößt, wird damit gleich eine Art Weltuntergang verbunden. Beispiel: „Wenn mir betriebsbedingt gekündigt wird, werde ich auf der Straße landen.“
Der innere Kritiker neigt außerdem dazu, mit zweierlei Maß zu messen. Man urteilt über andere anders als über sich selbst. Angenommen, man erfährt, dass ein Freund bei der praktischen Fahrprüfung durchgefallen ist. Natürlich könnte man denken: „Der hätte es eigentlich schaffen müssen“. Eine wahrscheinlichere Reaktion ist jedoch: „Das kann schon mal passieren. Wahrscheinlich war er zu aufgeregt.“ Wenn man selbst durch die Fahrprüfung fallen würde, denkt man eher: „Ich bin so blöd!“
Was hat das alles mit Selbstwertschätzung zu tun?
Der innere Kritiker ist ein dauerhafter Begleiter im Leben. Immer wieder teilt er sich über negative Gedanken mit, die immer wieder den Finger in offene Wunden legen. Diese Gedanken führen Unzulänglichkeiten vor Augen, denn es gibt immer etwas zu bemängeln, auszusetzen und zu kritisieren. Der innere Kritiker ist eigentlich nie zufrieden.
Leider hat der innere Kritiker auch ein gutes Erinnerungsvermögen. Dies ist kein Wunder, denn er hat ungehinderten Zugang zum Gedächtnis. So kann er, wenn er sich schon über negative Gedanken mitteilt, auch gleich noch Erinnerungen an ähnliche Erlebnisse oder Ereignisse in der Vergangenheit in das Bewusstsein rufen. „Du hat es damals schon nicht gekonnt! Wie konntest du auf die Idee kommen, dass du es diesmal kannst?“, mag ein abwertungsverstärkender Gedanke sein.
Bei dieser Art „Dauerbeschallung“ verwundert nicht, dass man sich unzulänglich und minderwertig fühlt. Die Selbstwertschätzung leidet, mangelndes Selbstvertrauen eine naheliegende Folge. Wenn man dem inneren Kritiker ungehindert Raum gibt, macht man sich letzten Endes selbst zum Feind.
Ist der innere Kritiker nur ein „Klotz am Bein“?
Der innere Kritiker ist zweifellos schädlich, wenn man ihn ungehindert wirken lässt. Doch ist er bei alldem immer nur der „Klotz am Bein“, den man am liebsten sofort loswerden möchte oder sogar zwingend müsste? Oder ist er auch auf irgendeine Weise sogar doch nützlich?
Wie bereits erwähnt, will der innere Kritiker vor Ermahnung und Strafe bewahren. Dies war schon in der Kindheit seine Hauptabsicht. Dadurch will er vor psychischen Belastungen schützen, wie sie beispielsweise durch Ablehnung, Ausgrenzung oder massive Kritik, entstehen können. Aus dieser Perspektive betrachtet ist der innere Kritiker nicht nur das negative, das Leben beschwerende „Monster“.
Der innere Kritiker als Team-Mitglied?
Der innere Kritiker lässt sich nicht ignorieren, man wird ihn nicht einfach los. Deshalb bleibt nur, einen guten Weg zu finden, um mit ihm leben zu können. Doch wie kann man ihm dabei seine zerstörerische Macht entziehen und ihn in die Schranken weisen?
Eine bewährte Möglichkeit besteht darin, den inneren Kritiker als Mitglied eines inneren Teams zu betrachten. Das Konzept des Inneren Teams wurde von dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun entwickelt. Es hilft dabei, die Vielfalt der inneren Stimmen zu verstehen und sie gut zu moderieren.
Das Innere Team besteht aus verschiedenen Mitgliedern, wobei jedes Mitglied unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit, Werte und Bedürfnisse repräsentiert und eine innere Stimme vertritt. „Ein Mensch hat viele Stimmen in sich. Im besten Fall bilden sie ein Team.”, so drückte Friedemann Schulz von Thun es aus. Beispiele für derartige Team-Mitglieder sind der Realist, der Träumer, der Beschützer und eben der (innere) Kritiker.
Jedes Team braucht einen Leiter, ein Oberhaupt, einen Vorsitzenden. Wie auch immer man die Rolle benennt: jemand muss entscheiden. Während einer Team-Sitzung dürfen alle Team-Mitglieder zu Wort kommen. Der Träumer darf seine Vision einbringen, der Realist darf sich auf Fakten berufen, usw. Der innere Kritiker ist nur ein Mitglied unter mehreren. Er darf sich melden, aber alle anderen Team-Mitglieder auch. Und er hat nicht mehr zu sagen als die anderen. Grundsätzlich hat der Vorsitzende, das übergeordnete „Ich“, das letzte Wort.
Innere Reaktionen auf den misslungenen Vortrag
Der misslungene Vortrag hat eine Vorgeschichte. So gut wie jeder Vortrag braucht eine gute Vorbereitung. Muss sich Markus bei ehrlichem Nachdenken möglicherweise eingestehen, dass er sich, als Beispiel, einfach nicht genügend Vorbereitungszeit genommen hat, obwohl er sie gehabt hätte?
Nach dem misslungenen Vortrag mag sich in Markus Gedankenwelt ein innerer Dialog entspinnen, etwa so:
Kritiker: „Das ist ja voll „in die Hose gegangen“! Du bist ein jämmerlicher Versager! Du kannst es einfach nicht! Du bist echt eine Niete!“
Verteidiger: „Dein Pauschalurteil, du könntest es einfach nicht und wärst eine Niete, stimmt nicht! Das war ein Vortrag von vielen, die du schon gehalten hast. Du hast schon viele gute Vorträge gehalten.“
Realist: „Ja, der Vortrag kam nicht gut an. Es gab berechtigte Kritik.“
Mutmacher: „Stimmt, du hast den Vortrag versemmelt. Das ist aber kein Weltuntergang. Du kannst es in Zukunft besser machen.“
Kritiker: „Du bist auch noch selbst schuld! Du hättest die Zeit gehabt, den Vortrag sorgfältig vorzubereiten, hast sie aber nicht genutzt.“
Mutmacher: „Ja, so war es. Lass es dir eine Lehre sein. Du kannst es besser. Du wirst wieder eine Chance bekommen.“
Verteidiger: „Deine Aufgabe besteht nicht nur darin, Vorträge zu halten. Du darfst dich auch daran erinnern, dass du kürzlich einen Verbesserungsvorschlag gemacht hast. Der ermöglicht es jetzt, Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Kritiker, hör mir mal gut zu: »Wenn du das Wort ‚Niete‘ aussprichst, lässt du diese anerkennungswerte Leistung einfach unter den Tisch fallen. Das geht so nicht!«
Beschützer: „Wenn du dir am Ende nichts vorwerfen willst, möchtest du den Vortrag gut vorbereiten.“
Vorsitzender: „Ich fasse zusammen und stelle Folgendes fest: Der Vortrag hätte deutlich besser sein können. Die Kritik war berechtigt. Weil es diesmal nicht gut lief, bedeutet das nicht, dass ich grundsätzlich ein Versager bin. Ich kann es in Zukunft besser machen, wenn ich mich besser vorbereite.“
Wenn Markus in seiner Gedankenwelt nur dem inneren Kritiker Raum gibt, verwundert nicht, dass er sich selbst klein und schlecht macht. Der innere Kritiker betont das Negative und will Markus mit seinem negativen Pauschalurteil festhalten. Seine Selbstwettschätzung wird darunter leiden.
Lässt Markus auch andere Stimmen zu Wort kommen, verliert das vermeintliche Versagen seine Wucht. Markus hat in einer bestimmten Situation Erwartungen nicht erfüllt, nicht mehr und nicht weniger. Hat der innere Kritiker etwa darauf hingewiesen, dass Markus seine Fähigkeiten und Kompetenzen in einem anderen Bereich vorteilhaft eingebracht hat?
Wenn der innere Kritiker Gegenspieler bekommt, wird ihm Macht entzogen. Er hat keinen Alleinvertretungsanspruch mehr. Er ist nur eine von mehreren Stimmen. Auch die anderen Stimmen können sich Gehör verschaffen.
Weiterführende Fragen
- Wie gehe ich mit meinem inneren Kritiker um?
- Welche Rechte hat der innere Kritiker in meiner Gedankenwelt?
- Bei welchen Themen bin ich besonders empfindlich, dem inneren Kritiker Raum zu geben?