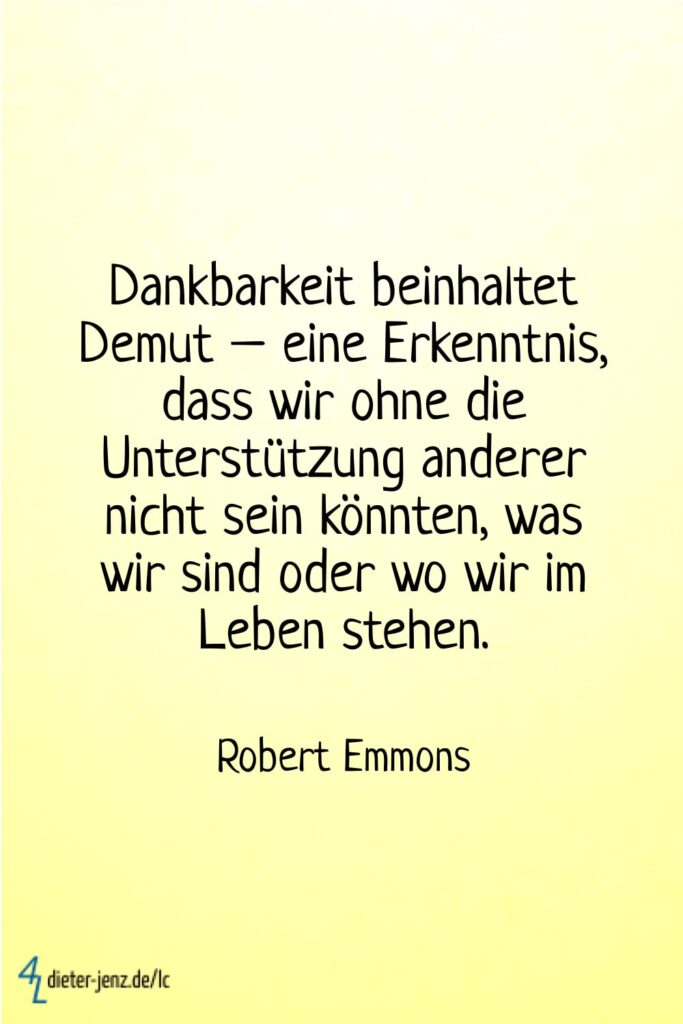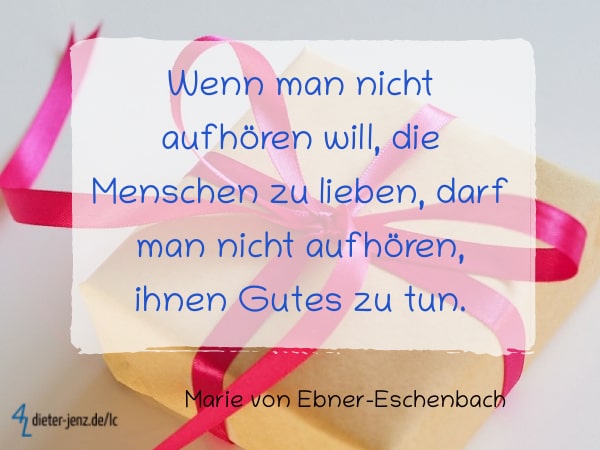Unvollkommenheit akzeptieren – leichter gesagt als getan! Wie lassen sich Unzufriedenheit mit sich selbst und Selbstvorwürfe überwinden?
Inhalte:
„Nimm deine Unvollkommenheit an und habe keine Angst davor, aufzufallen!“ So äußerte sich einmal die US-amerikanische Schauspielerin Sandra Bullock. Sie sei mit sich zufrieden, solange sie das Gefühl habe, ihr Bestes zu geben. Früher habe sie perfekt sein wollen, aber wenn man perfekt sein wolle, mache man sich nur kaputt. In einer Welt, in der oft versucht werde uns vorzugeben, wer wir sein sollen, sei es das Kraftvollste, sich selbst treu zu bleiben. Sie habe Frieden mit der Tatsache geschlossen, dass die Dinge, die sie für Schwächen oder Mängel gehalten habe, einfach zu ihr gehören. Sie möge diese.
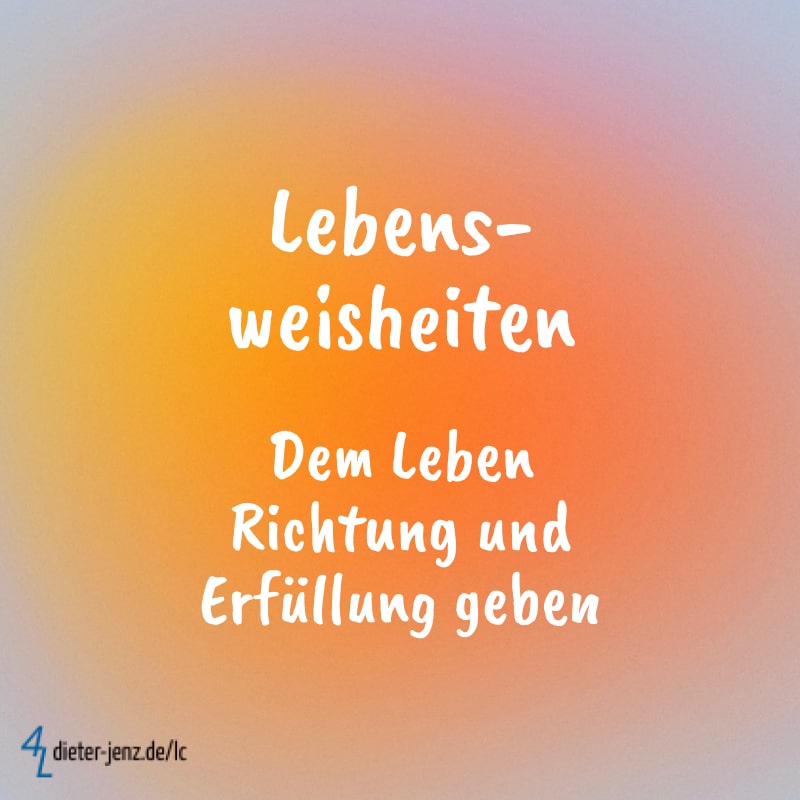

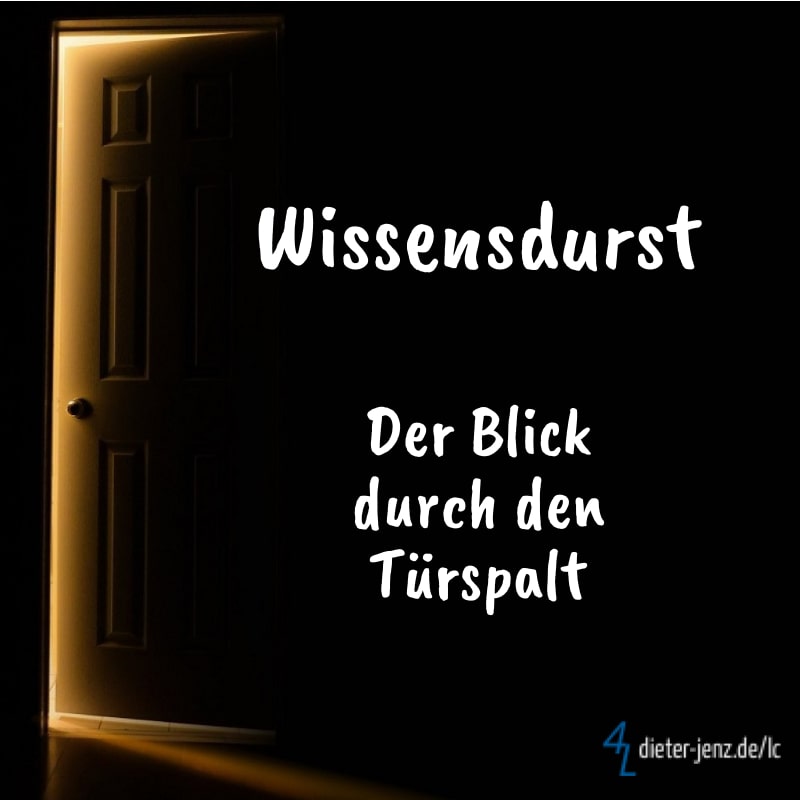
Was ist Vollkommenheit und gibt es sie überhaupt?
Etwas Vollkommenes ist ohne jeden Fehler oder Makel und bedarf keiner Verbesserung oder Ergänzung mehr. Somit bezeichnet Vollkommenheit einen optimalen, nicht mehr zu übertreffenden Zustand.
Aus einer anderen Perspektive betrachtet ist Vollkommenheit das Ergebnis eines Prozesses. Es wird, als Beispiel, etwas erschaffen oder gestaltet, das nach Abschluss des Prozesses objektiv zur Perfektion und Vollendung gebracht ist. Das Wort „perfekt“ hat seine Wurzel in dem lateinischen Verb „perficere“, was so viel wie „vollenden“ bedeutet.
Gibt es in unserer Welt überhaupt etwas nach dieser Bedeutungsweise objektiv Vollkommenes? Gibt es etwas, von dessen Vollkommenheit alle Menschen ausnahmslos überzeugt sind?
Die Fragen lassen sich durchaus mit „ja“ beantworten, dies allerdings nur, wenn relativ „einfache“ Dinge betrachtet werden. Ein Würfel aus Keramik, als Beispiel, kann in seiner Exaktheit der Abmessungen, in der gleichmäßigen Glätte seiner Oberfläche usw. so gestaltet sein, dass – zumindest für das menschliche Auge – keine weitere Verbesserung mehr möglich ist.
Anders fallen die Antworten aus, wenn komplexere Dinge in den Blick genommen werden. Kann etwas von Menschen Geschaffenes, beispielsweise Bauwerke, Autos, Literatur, Gemälde u. v. m. objektiv vollkommen sein? Können Lebewesen objektiv vollkommen sein? Hier lauten die Antworten sehr klar „nein“!
Die Tatsache, dass objektive Vollkommenheit zumindest bei komplexeren Dingen nicht existiert und auch ein unerreichbares Ziel ist, bedeutet nicht, dass auch ein subjektives Empfinden von Vollkommenheit unmöglich ist. Es mag beispielsweise sein, dass ein Mensch ein bestimmtes Gemälde aus seiner Sicht als vollkommen empfindet. Andere Menschen, mit denen er darüber spricht, teilen seine Einschätzung jedoch nicht. In ihrer Sicht ist es insgesamt unvollkommen. In der Konsequenz bedeutet Vollkommenheit für jeden Menschen etwas anderes.
Geht es um ganzheitliche Vollkommenheit oder um Idealzustände?
Wie bereits erwähnt, kann etwas Vollkommenes nicht mehr verbessert werden. Da aber Vollkommenheit als Ganzheitszustand für Menschen nicht erreichbar ist, bleibt nur die Fokussierung auf einzelne Aspekte, für die Vollkommenheits- oder Idealzustände erreichbar sind.
Ein Beispiel für derartige Idealzustände sind Schönheitsideale. Schon in der Antike gab es eine Art ideale Schönheit, die mit dem Begriff „kalokagathia“ ausgedrückt wurde. Diese Art ideale Schönheit bezog sie jedoch auf die Harmonie von Körper und Seele. Interessanterweise scheint diese Art von Vollkommenheit in der heutigen Gesellschaft nicht gerade hoch im Kurs zu stehen. Vielmehr assoziieren Menschen mit Schönheit vor allem etwas Vollkommenes, Einwandfreies oder Makelloses.
In der Gegenwart sind Schönheitsideale, somit wenig verwunderlich, hauptsächlich auf körperliche Schönheit ausgerichtet. Gestylte Personen, die Gesundheit und Schönheit ausstrahlen, werden in den Medien als erstrebenswertes Modell präsentiert oder präsentieren sich selbst in dieser Weise. In Wirklichkeit helfen diese Personen, oft Models, mehr oder weniger intensiv nach, um so auszusehen, wie sie aussehen wollen oder sollen. Die Kosmetikindustrie bietet jede Menge Hilfsmittel an, um den Körper anders erscheinen zu lassen als er in Wirklichkeit ist. Davon abgesehen ermöglichen Bildbearbeitungsprogramme eine weitreichende Manipulation. Mit entsprechender Bildbearbeitung ist es mit einfachen Mitteln möglich, dem Betrachter etwas vorzuspiegeln, was nicht ist, ihn bewusst zu täuschen.
In der Konsequenz handelt es sich um Fake, also um eine Fälschung, einen Schwindel, eine Täuschung. Unweigerlich stellen sich Fragen:
- Was sind die Motive für bewusste Täuschungen?
- Wer hat ein Interesse an Täuschungen?
Sehr vereinfacht ausgedrückt lassen sich die Motive mit der Aussage „weil damit Geld zu verdienen ist“ zusammenfassen. Auch die Frage, wer ein Interesse daran haben könnte, anderen Menschen ständig ihre Unzulänglichkeiten vor Augen zu führen, lässt sich sehr einfach beantworten: „derjenige, der Geld verdienen möchte“.
Da die allerwenigsten Menschen über einen makellosen und dem gängigen Schönheitsideal entsprechenden Körper verfügen, vernehmen sie die unausgesprochene Botschaft: „So sollst du aussehen!“ Und in weiterer Konsequenz bedeutet dies: „Um dem Ideal entsprechen zu können, musst du deine Mängel beheben! Und wenn du das nicht schaffst, entsprichst du nicht den Erwartungen!“ Doch das Ideal ist nur Schein, eine Täuschung.
Will man sich letzten Endes einer Scheinwelt unterwerfen, in der andere aus naheliegenden Interessen heraus Maßstäbe setzen oder dies zumindest versuchen? Beantwortet man die Frage für sich mit einem „ja“, kann dies ein Streben nach Perfektion auslösen.
Dieses Streben nach Perfektion ist nicht per se negativ zu sehen. Es gibt durchaus Bereiche, in denen es unbedingt notwendig ist. Von einem Chirurgen, als Beispiel, wird erwartet, dass er nach Perfektion strebt. Schließlich sollen auch komplizierteste Operationen gelingen. Schon der kleinste Fehler kann fatale Folgen haben. Andererseits kann sich das Streben nach Perfektion jedoch als problematisch und hemmend erweisen, wenn es nicht um Sicherheit, Unversehrtheit oder gar das Überleben geht.
Will man sich dem Perfektionismus hingeben?
Das Bestreben, einem Idealzustand zu entsprechen, erfordert eine Methode, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Methode ist der Perfektionismus. Damit ist ein Streben nach Fehlerlosigkeit gemeint. Dessen Motiv ist jedoch im Allgemeinen nicht die Liebe zur Vollkommenheit, sondern vielmehr ein angstbesetztes Vermeidungsverhalten. Perfektionismus ist nicht nur Methode, sondern auch Prozess.
Ein Perfektionist stellt hohe Ansprüche an sich selbst, setzt sich hohe Ziele und Standards. Letztlich fordert er von sich selbst, keine Fehler zu machen. Es verwundert nicht, dass mit Perfektionismus häufig eine große Versagensangst einhergeht. Er möchte nicht scheitern und gleichzeitig anderen keinen Anlass zu Tadel geben. Die Angst, sich selbst oder anderen nicht zu genügen, nimmt im Leben des Perfektionisten großen Raum ein. Auch die Angst, bei anderen Menschen Wertschätzung und Ansehen zu verlieren, spielt eine wesentliche Rolle. Mit dem Streben nach Fehlerlosigkeit ist außerdem das Bestreben nach Unangreifbarkeit verknüpft.
Diese „inneren Antreiber“, die mit dem Grundmotiv „sei perfekt!“ verknüpft sind, bringen den Perfektionisten dazu, ein „getriebenes“ Leben in Kauf zu nehmen. Entweder setzt er sich selbst hohe Ziele und Standards oder er überlässt dies anderen und übernimmt sie für sich. In der Konsequenz unterwirft er sich dem Diktat anderer, wie „man“ zu sein hat. Bei alldem tritt beim Perfektionisten die Freude an dem, was er tut, in den Hintergrund. Perfektionismus wird letzten Endes zu einer ziemlich freudlosen und vielleicht sogar frustrierenden Angelegenheit.
Ist man bereit, seine Unvollkommenheit zu akzeptieren?
Wenn Perfektionismus als Option ausscheidet bleibt nur, Unvollkommenheit zu akzeptieren und mit ihr zu leben. Das eine schließt das andere aus. Gleichwohl ist damit keinesfalls gemeint, keine Ziele mehr zu verfolgen, sich nicht mehr anzustrengen oder sich gar gehen zu lassen. Es bedeutet lediglich, auf das Streben nach Perfektion zu verzichten.
Die Bereitschaft, Unvollkommenheit zu akzeptieren, bedeutet auch, Tatsachen zu akzeptieren. Unvollkommenheit zu leugnen schafft sie nicht aus der Welt. Beim Menschen beginnt die Unvollkommenheit de facto schon mit der Geburt und setzt sich durch das ganze Leben fort. Unvollkommenheit ist gewissermaßen chronisch. Deshalb wird auch ein Perfektionist trotz aller Bemühungen nie von sich behaupten können, er mache nie Fehler.
In der Konsequenz sorgt man gut für sich, wenn man seine Unvollkommenheit akzeptiert. Man befreit sich selbst vom Stress und der Angst, die mit dem Perfektionismus verbunden sind. Wenn man seine Unvollkommenheit annehmen kann, fällt es sehr viel leichter, mit sich selbst nachsichtig zu sein und sich zu verzeihen. Aber auch die Mitmenschen profitieren davon, denn auch von ihnen erwartet man keine Vollkommenheit. Deshalb kann man auch mit anderen nachsichtig sein und ihnen verzeihen.
Was hat das alles mit Selbstwertschätzung zu tun?
Ein Perfektionist hat es schwer, zu einer gesunden Selbstwertschätzung zu finden. Er neigt dazu, seine Selbstwertschätzung an seine Erfolge und die Wertschätzung anderer zu binden. Die Anerkennung des Erfolgs durch Mitmenschen kann sich in vielfältiger Weise ausdrücken, beispielsweise durch Likes in sozialen Medien. Doch Erfolg ist nicht gleichbedeutend mit Wertschätzung. Darüber hinaus ist beides vergänglich. Außerdem macht man sich vom Urteil anderer Menschen abhängig.
Was würde es für einen Perfektionisten bedeuten, wenn ein angestrebtes Ziel auf einmal überhaupt nicht mehr erstrebenswert ist? Vielleicht hat sich der Zeitgeist geändert. Plötzlich ist etwas, was jahrelang eine Leitlinie war, nicht mehr relevant. Es muss ihm wie eine Vergeudung von Lebenszeit vorkommen.
Die soziale Wertigkeit des Menschen hängt nicht von seinen Erfolgen oder Misserfolgen ab. Wenn man dies anerkennt und in ganzer Tiefe bejaht, fällt es viel leichter, von sich selbst und anderen, keine Vollkommenheit zu fordern. Und man kann sich selbst und andere von Herzen wertschätzen.
Was hat das alles mit Authentizität zu tun?
Wenn man an sich selbst keine – ohnehin unerfüllbaren – Vollkommenheitsansprüche stellt, macht man es sich leichter, sein wahres individuelles Selbst mit allen Unvollkommenheiten anzunehmen. Dann kann man auch zulassen, seine echte Persönlichkeit zu zeigen. Man muss keine Maske vermeintlicher Perfektion aufsetzen. Man kann zu seinen Stärken und Schwächen stehen. Mit anderen Worten: man kann authentisch sein. Von anderen wird man als echt, unverfälscht, wahrhaftig und glaubwürdig empfunden, denn man steht in Einklang mit sich selbst.
Wer nicht nur zu seinen Stärken, sondern auch zu seinen Schwächen stehen kann, macht es auch sich selbst leichter, aus Fehlern zu lernen. Fehler geschehen ganz zwangsläufig. Die Denkweise, Probleme und Herausforderungen als Chancen für Wachstum und positive Veränderung zu sehen, hilft dabei, sich Fehler zu verzeihen. Und sie verändert den Blick, weg von einer Verbissenheit der Fehlersuche, hin zu mehr Aufgeschlossenheit beim Erkennen von Lösungsmöglichkeiten.
Weiterführende Fragen
- Was sind meine „inneren Antreiber“, die Vollkommenheit von mir einfordern?
- Gibt es bei mir Glaubenssätze, die es mir schwer machen, meine Unvollkommenheit zu akzeptieren?
- Was kann ich konkret tun, um meine Unvollkommenheit bereitwillig zu akzeptieren?