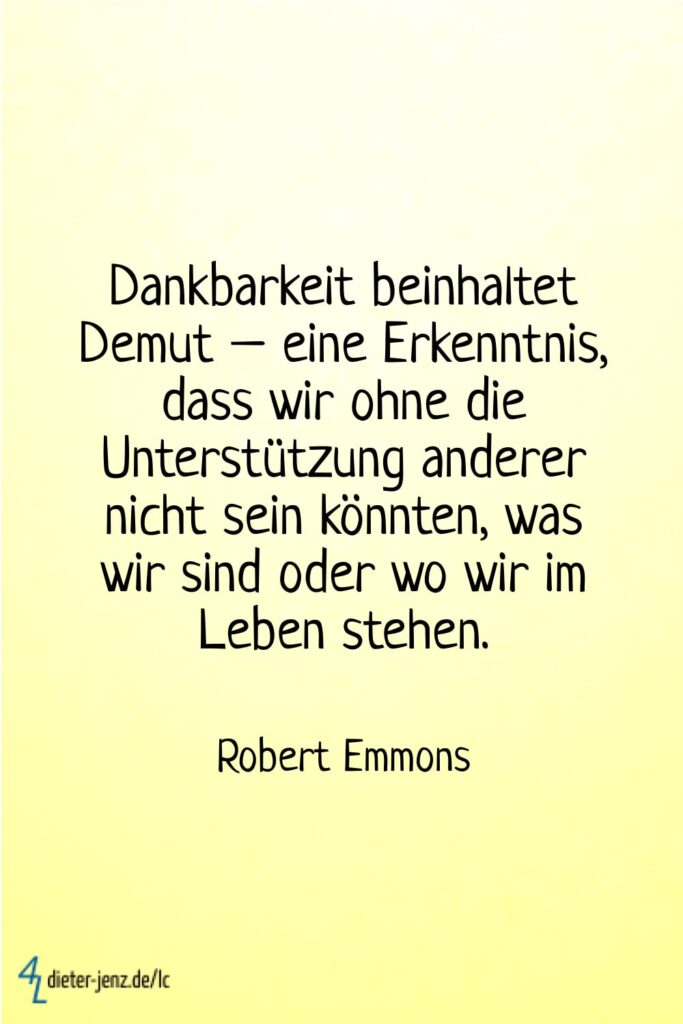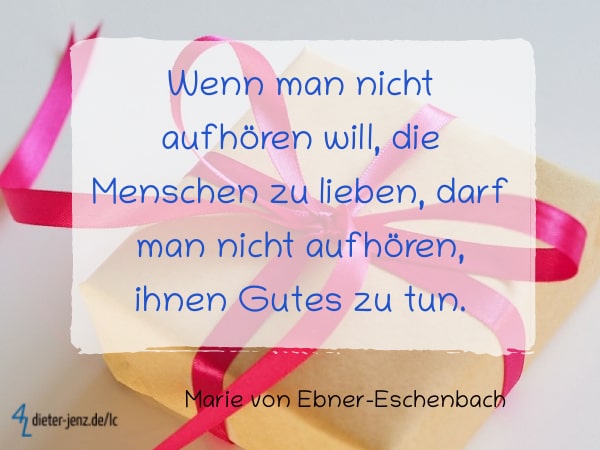Akute Selbstwertkränkungen – wie kann man selbstwertschützend reagieren und agieren? Wie kann man in solchen Situationen gut für sich selbst sorgen?
Inhalte:
Selbstwertschützend reagieren und agieren
Nun ist es also passiert. Es ist zu einer Kränkung des Selbstwertgefühls gekommen. Auf dem imaginären Leitstand des inneren Kraftwerks leuchtet, bildlich ausgedrückt, die Lampe „Selbstwertkränkung“ rot auf. Vielleicht ertönt – um im Bild zu bleiben – auch ein Warnton, um die Aufmerksamkeit zu wecken.
In einem konventionellen Kraftwerk würde ein Operator auf eine Betriebsstörung reagieren. Wenn ein Problem und die Reaktionsmöglichkeiten darauf bereits bekannt sind, kann die Störungsbehebung direkt erfolgen. Ansonsten muss zunächst die Ursache gefunden werden, wobei in der Regel im Betriebs- oder auch Störungshandbuch nachgesehen wird.
Auch für das imaginäre innere Kraftwerk lässt sich ein Verfahren zur Behebung des Störfalls einer Selbstwertkränkung entwickeln und festlegen. Schließlich soll vermieden werden, dass man durch ein Kränkungsereignis völlig aus der Bahn geworfen wird. Vielmehr ist es wichtig, im Fall einer Selbstwertkränkung – zu der es jederzeit kommen kann – schnell reagieren und agieren zu können, um gut für sich selbst zu sorgen.
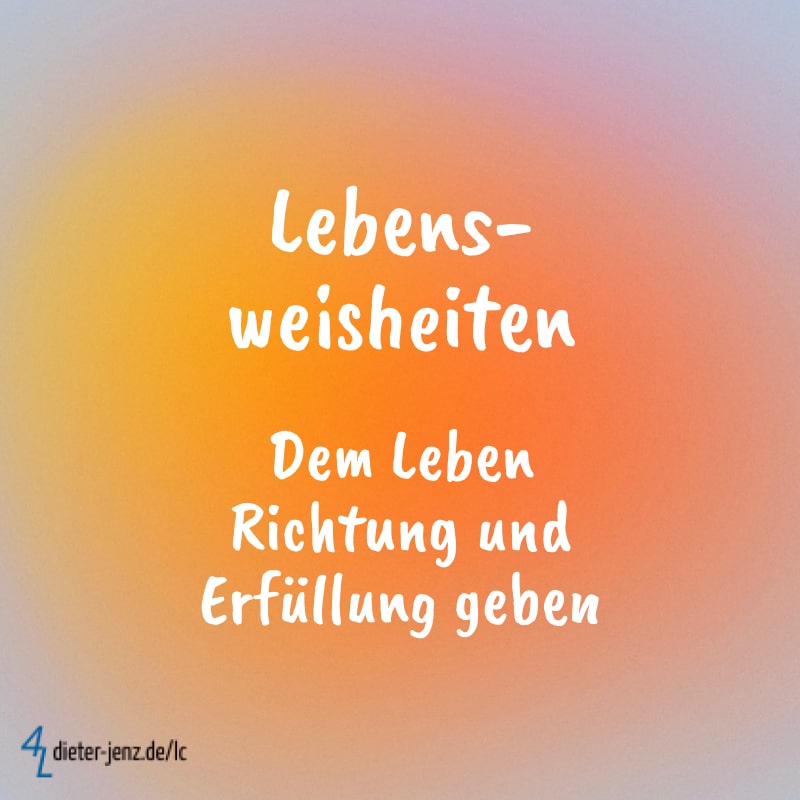

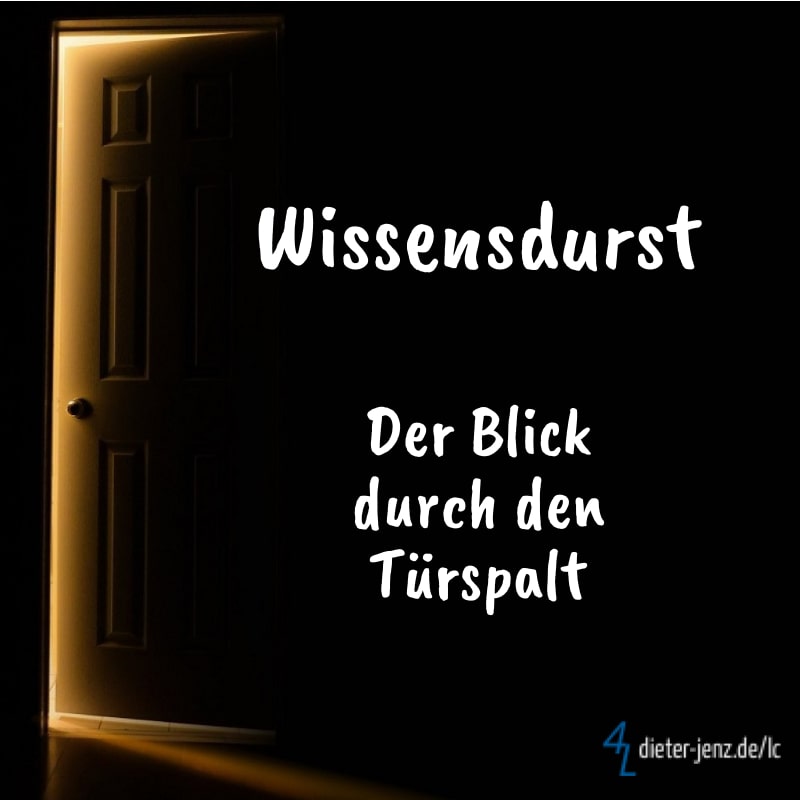
Bewertungsmuster im Gehirn
Kränkungen des Selbstwertgefühls geschehen fast immer unerwartet. Es mag sein, dass man sich selbst gegenüber unachtsam war und in eine altbekannte Falle getappt ist. Vielleicht war es die Falle des „sich-vergleichens“. Die überhaupt nicht so attraktive Kollegin hat schon wieder jemand kennengelernt und man selbst wartet noch immer auf den Traummann. Oder der überhaupt nicht so attraktive Kollege hat … Zwar ist man sich bewusst, dass das „sich-vergleichen“ schnell in eigener Abwertung enden kann, aber es ist trotzdem geschehen. Es mag andererseits aber auch sein, dass das Selbstwertgefühl durch eine andere Person verletzt wurde. Vielleicht wurde man von einer Person bloßgestellt, von der man dies nie erwartet hätte.
Wann es zu einer Selbstwertkränkung kommt, ist unvorhersehbar. Mehrere neuronale Systeme im Gehirn suchen das Umfeld fortwährend auf Signale hin ab, ob wichtige Bedürfnisse – insbesondere die Bedürfnisse nach Sicherheit, Zufriedenheit und Verbundenheit – nicht befriedigt werden. Bildlich ausgedrückt, befindet sich in unserem Gehirn ein Radargerät. Die Antenne dreht sich ständig. Auf dem „Radarschirm“ erscheinen sowohl positive als auch negative Wahrnehmungen. Eine negative Wahrnehmung löst nicht unbedingt gleich eine Art Alarm aus. Ist einem beispielsweise der Bus „vor der Nase weggefahren“, wird dies nur dann als problematisch bewertet, wenn man dadurch zeitlich in Bedrängnis gerät und vielleicht einen Termin verpasst. Werden jedoch die bereits genannten wichtigen Bedürfnisse gefährdet, wird definitiv eine Art Alarm ausgelöst.
Wenn auf dem imaginären Radarschirm eine negative Wahrnehmung erkannt wird, geschieht unbewusst ein Zugriff auf das implizite Gedächtnis. Das implizite Gedächtnis ist der Teil des Gedächtnisses, in dem Erfahrungen und Fähigkeiten gespeichert werden, die unbewusst abgerufen werden. Auch das implizite Gedächtnis weist eine Tendenz zu negativer Bewertung auf. Unerfreuliche Erfahrungen werden im impliziten Gedächtnis schnell gespeichert, um künftig derartige Erfahrungen möglichst vermeiden zu können. „Gebranntes Kind scheut das Feuer“ ist ein bekanntes Sprichwort, welches das Prinzip gut wiedergibt: Wenn man einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, versucht man daraufhin, Ähnliches zu vermeiden. Demgegenüber werden neutrale und auch erfreuliche Erfahrungen im Verhältnis zu den unerfreulichen eher kaum im impliziten Gedächtnis gespeichert, da sie meist als „nichts Besonderes“ angesehen werden.
Positive und negative Wahrnehmungen werden im menschlichen Gehirn nicht gleich bewertet. Es tendiert dazu, negative Wahrnehmungen höher zu bewerten als positive. Außerdem tendiert es dazu, Gefahren und Bedrohungen zu überschätzen, und Chancen und Ressourcen zu unterschätzen.
Die Tendenz zur Höherbewertung von Negativem zeigt sich im täglichen Leben auf vielfältige Art und Weise. Im Allgemeinen lernen wir, wie bereits angedeutet, schneller durch eine schmerzliche als durch eine erfreuliche Erfahrung. Tiefsitzende Abneigungen eignen wir uns schneller an als ausgeprägte Vorlieben. Wir erinnern uns schneller an etwas Negatives über eine Person als über etwas Positives. Vertrauen kann schnell verlorengehen und lässt sich nur schwer zurückgewinnen. Die Aufzählung an Beispielen ließe sich noch weiterführen.
Nachsicht gegen sich selbst
Es gibt viele Situationen, in denen wir selbst unser Selbstwertgefühl verletzen, uns gewissermaßen selbst kränken. Nicht nur das „sich-vergleichen“ mit anderen ist ein häufiger Anlass für eine Verletzung des Selbstwertgefühls. Auch wenn wir an unseren eigenen perfektionistischen Maßstäben scheitern und uns selbst abwerten, wenn sie nicht erreicht werden, kränken wir uns selbst. Und auch wenn wir uns vom inneren Kritiker niedermachen lassen, verletzen wir unser Selbstwertgefühl.
Ändern wir etwas an der Situation, wenn wir uns Selbstvorwürfe machen? Sicherlich nicht! Die Selbstwertkränkung ist bereits geschehen und sie kann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden. Mit Selbstvorwürfen fügen wir uns nur noch weiteren Schmerz zu.
Wenn wir ohnehin nichts mehr ändern können, ist Nachsicht mit sich selbst sicherlich das beste Mittel, um den Blick nach vorne nicht zu verstellen: „Es ist passiert. Ich kann es nicht mehr ändern. Ich sehe es mir selbst nach.“
Reaktion auf akute Selbstwertkränkungen
Ist es sinnvoll, spontan und impulsiv auf eine empfundene Kränkung des Selbstwertgefühls zu reagieren? Oder empfiehlt es sich eher, sich einen Moment zu zügeln, um einen klaren Gedanken fassen zu können?
Ohne Zweifel ist es sinnvoll, nicht spontan und intuitiv zu reagieren. Wenn immer möglich, sollte man sich Zeit verschaffen, um kurz nachdenken und dann kontrolliert reagieren zu können. Es kann durchaus hilfreich sein, den Ort des Geschehens zu verlassen, um auch räumliche Distanz zu gewinnen.
Noch besser ist es, eine Art „Drehbuch“ zu entwickeln, wie man auf eine Selbstwertkränkung reagiert. Dieses „Drehbuch“ beschreibt eine Abfolge von Schritten, die auch ein Eskalationsschema widerspiegelt:
- Problemquelle bestimmen
- Gedanken ordnen im inneren Kraftraum
- Selbstwertkränkung mit Vertrauensperson besprechen
- Akutunterstützung durch Fachperson
Wenn es in einem dieser Schritte gelingt, auf die Selbstwertkränkung gut zu reagieren, ist ein Zustand inneren Gleichgewichts wiederhergestellt. „Es ist wieder gut so, wie es jetzt ist“, „Jetzt bin ich wieder ganz bei mir“, oder „Jetzt fühlt es sich für mich wieder stimmig an“, sind beispielhafte Aussagen, die den inneren Eindruck widerspiegeln.
Gelingt es in einem dieser Schritte nicht, einen Zustand inneren Gleichgewichts wiederherzustellen, wird gewissermaßen eskaliert und mit dem nächsten Schritt fortgesetzt. Die Abfolge dieser Schritte lässt sich auch als kontrollierter Weg in Richtung professioneller Unterstützung verstehen.
Problemquelle bestimmen
Wenn das Selbstwertgefühl verletzt wird, neigen wir dazu, das Problem zuerst bei uns selbst zu suchen. Vielleicht fühlt man sich zurückgewiesen oder gar zurückgestoßen und denkt, man müsse der anderen Person dafür doch einen Anlass gegeben haben. Doch entspricht dies auch wirklich den Tatsachen?
Angenommen, man ist Opfer von Ghosting geworden. Man hat eine Person kennengelernt, zu der man sich hingezogen fühlt. Man trifft sich einige Male und verbringt schöne Zeiten zusammen. Und man hofft, dass sich eine längere Beziehung entwickelt. Doch plötzlich meldet sich diese Person nicht mehr. Sie reagiert auch nicht mehr auf Kontaktversuche. Diese laufen ins Leere, denn die Kontaktaufnahme wurde blockiert.
Die Beziehung hängt gewissermaßen in der Luft. Da die andere Person eine Erklärung für ihr Verhalten verweigert, gibt es für die Beziehung keinen Abschluss. Im Herzen mag eine mehr oder weniger tiefe Wunde zurückbleiben. Es verwundert nicht, wenn sich das Gedankenkarussell zu drehen beginnt. „Hätte ich …“ oder „hätte ich nicht …“, so beginnen häufig Fragen, die man an sich selbst stellt. Stellt man sich dann auch noch selbst die Frage: „Genüge ich nicht?“, ist der Weg zur Selbstwertkränkung nur noch sehr kurz. Schließlich lautet die mögliche Folgerung: „Wenn ich genügen würde, dann würde ich von dieser Person ja nicht zurückgewiesen werden.“
Ist es richtig, Geschehenes nur auf sich zu beziehen? Wenn nein, führt man sich selbst zu der Frage: Wer genau hat das Problem? Ist man selbst das Problem oder hat die andere Person ein Problem? Was wäre, wenn der Ghoster das Problem hat und ist? Weshalb? Weil er nicht in der Lage ist, sich zu binden.
Wenn man zum Ergebnis gelangt, dass der Ghoster das Problem hat und ist, hat man sich gleichzeitig selbst aus der Verantwortung entlassen. Für Probleme des Ghosters ist man schlicht nicht zuständig. Weshalb sollte man sich dann von ihm auch noch kränken lassen?
Die folgenden Inhalte befinden sich im Buch:
- Gedanken ordnen im inneren Kraftraum
- Selbstwertkränkung mit Vertrauensperson besprechen
- Akutunterstützung durch Fachperson
Schutz des Selbstwertgefühls – ungemein wichtig
So wichtig es ist, das Selbstwertgefühl zu stärken, so wichtig ist es auch, es zu schützen. Was würde es nützen, alles dafür zu tun, um das Selbstwertgefühl zu stärken, aber nichts dafür, es zu schützen? Wäre etwa ein Bergsteiger gut beraten, alles für seine körperliche Fitness und die Verbesserung seiner bergsteigerischen Fähigkeiten zu unternehmen, aber auf Schutzausrüstung (insbesondere Schutzhelm) zu verzichten? Sicherlich nicht! Während einer Bergtour ist schließlich damit zu rechnen, dass die Schutzausrüstung auch tatsächlich benötigt wird.
Im Alltag wird es immer wieder zu Situationen kommen, in denen Mitmenschen das Selbstwertgefühl unabsichtlich (beispielsweise durch eine Absage nach der Bewerbung um eine Arbeitsstelle) oder absichtlich (beispielsweise durch herabwürdigendes Nachäffen) verletzen. Und es wird zu Situationen kommen, in denen man selbst nicht ausreichend auf sein Selbstwertgefühl achtet und dessen Verletzung zulässt. Deshalb ist es ungemein wichtig, sich auf derartige Situationen vorzubereiten und über eine Lösungsstrategie zu verfügen, wie man auf eine akute Selbstwertkränkung reagiert und das Selbstwertgefühl schützt.
Wir werden, bildlich ausgedrückt, immer wieder von Schlägen getroffen, vielleicht sogar hart, aber wir können Schläge besser wegstecken. Und sollte es doch zu einem sinnbildlichen Niederschlag kommen, dann kommen wir schneller wieder auf die Beine. Schutz ist wichtig!