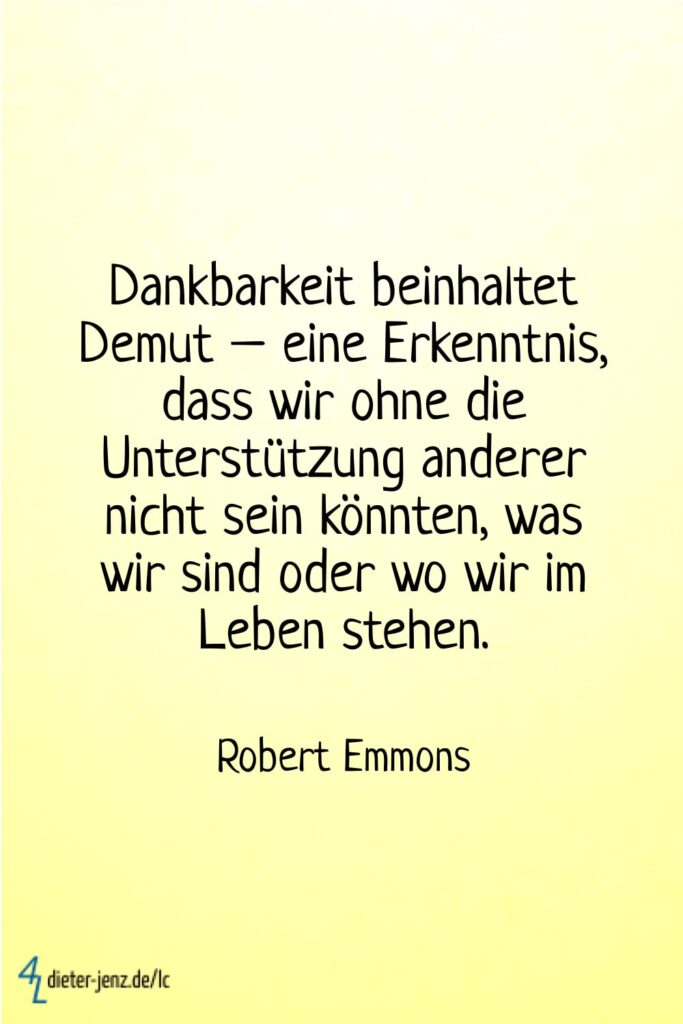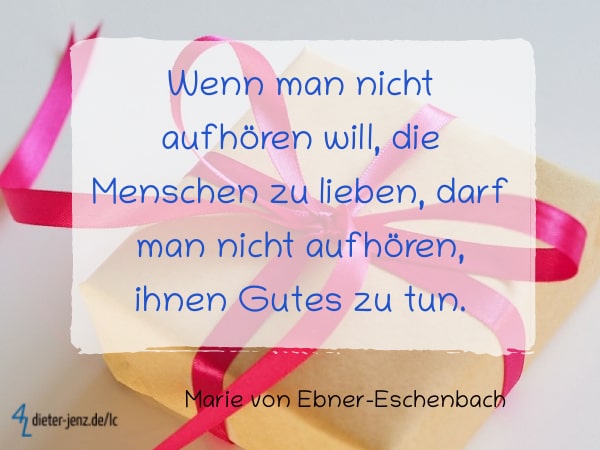„Wenn die Hoffnung aufwacht, legt sich die Verzweiflung schlafen.“
Asiatische Weisheit

Verzweiflung und Hoffnung – Hoffnung und Verzweiflung
Es geschah am 5. August 2010. Am Rand der Stadt Copiapo in der chilenischen Atacama-Wüste stürzte die kleine Gold- und Kupfermine San José ein. 33 Bergleute wurden in rund 700 Metern unter der Erde verschüttet. Sofort wurde eine Rettungsaktion eingeleitet. Diese musste jedoch unterbrochen werden, da die Helfer durch Steinschlag gefährdet und sogar beinahe selbst verschüttet wurden.
Sondierbohrungen zu möglichen Rückzugsorten der Verschütteten wurden vorgenommen. Da diese zunächst keinen Erfolg brachten, schwand in den folgenden Tagen die Hoffnung immer mehr, die Bergleute zu finden und lebend retten zu können. Eine Woche später, am 12. August, erklärt das Bergbauministerium, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rettung gering sei, zumal noch immer jedes Lebenszeichen fehlte.
Geringe Erfolgswahrscheinlichkeit aber immer noch Hoffnung?
Die Bemühungen, die Bergleute zu orten, gingen dennoch weiter. Schließlich, weitere 10 Tage später, am 22. August, konnten die verschütteten Bergleute nach insgesamt über zweiwöchiger völliger Abgeschiedenheit lebend geortet werden. Über eine dieser Bohrungen konnte sodann eine Verbindung zu ihnen hergestellt werden. Die Bergleute konnten einen Zettel an das Bohrgestänge kleben und nach oben schicken, auf dem „Uns 33 im Schutzraum geht es gut“ stand. Eine Minikamera wurde heruntergelassen, über die Angehörige die Eingeschlossenen sehen konnten. Am folgenden Tag konnte erstmals Verpflegung nach unten gelangen.
Oben wurde inzwischen fieberhaft daran gearbeitet, herauszufinden, wie die Bergleute wieder möglichst sicher an das Tageslicht gebracht werden konnten. Erste Pläne gingen davon aus, dass sich die mögliche Rettung der Bergleute bis Weihnachten 2010 hinziehen könnte. Die Eingeschlossenen erfuhren diese Nachricht am 23. August.
Die Medien berichteten weltweit über das Ergehen der Verschütteten. Hilfsangebote gingen ein, so auch von der US-Weltraumbehörde NASA. Fachleute der NASA unterstützten mit Expertenwissen zum Umgang mit Eingeschlossenen. Im Mittelpunkt stand, wie die Zuversicht der 33 Bergleute über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden konnte.
Nach der Lokalisierung der Verschütteten waren Hoffnung und auch die Perspektive auf Rettung vorhanden. Aber es folgten noch 52 von mancher Unsicherheit geprägte Tage. Endlich, nach insgesamt 69 Tagen, und dennoch weitaus früher als ursprünglich angenommen, wurden alle Eingeschlossenen wohlbehalten in Rettungskapseln an die Erdoberfläche geholt. Noch nie zuvor waren Menschen so lange Zeit unter Tage eingeschlossen und überlebten.
Angehörige, Rettungskräfte, und auch die Eingeschlossenen selbst gingen während dieser 69 Tage durch ein Wechselbad der Gefühle. Verzweiflung und Hoffnung wechselten einander auf der ganz individuellen Ebene ab.
Wie ging es den eingeschlossenen Bergleuten?
Die verschütteten Bergleute versuchten, nachdem ihnen ihre Lage bewusst war, über einen Wetterschacht nach oben zu gelangen. Sie stiegen etwa 400 Meter nach oben, kamen dann jedoch nicht mehr weiter. Eine Rettungsleiter, die sich dort eigentlich befinden sollte, war nicht an ihrem Platz. Ihnen blieb nichts anderes übrig als wieder nach unten zu steigen und sich in den in rund 700 Metern Tiefe gelegenen Schutzraum zurückzuziehen.
Frühzeitig wurden Rollen und Zuständigkeiten zugewiesen. Der Schichtleiter Luis Urzúa übernahm die Führung der Gruppe. Der älteste unter den Eingeschlossenen, der damals 63-jährige Mario Gómez, kümmerte sich um seelische Belange. Ein anderer Bergmann, der über gewisses medizinisches Wissen verfügte, widmete sich medizinischen Belangen und führte auch Impfungen durch.
Jeden Tag versammelten sich die Eingeschlossenen, um sich gemeinschaftlich abzustimmen. In ihrer Situation gab es manches zu regeln, so beispielsweise auch die Verteilung der noch vorhandenen Essensvorräte. 17 Tage lang konnten sie nicht wissen, ob sie überhaupt gerettet werden würden. Dennoch gingen sie von der Möglichkeit aus und teilten sich die Essenvorräte ein. Pro Tag und Person gab es zwei Löffel Thunfisch und einen Löffel Milch.
Die Bergleute gaben ihren Tagen eine Struktur mit festgelegten Zeiten für Schlafen, Arbeit und Freizeit. Sie teilten sich in drei Gruppen mit jeweils spezifischen Aufgabenstellungen auf und konnten sich auf Tagesziele konzentrieren. Nachdem die Kommunikation mit der Außenwelt möglich war, wurde mit Unterstützung von Psychologen ein ausgeklügeltes Beschäftigungs- und Fitnessprogramm umgesetzt, um die belastende Zeit in der Tiefe überstehen zu können. Dass jeder eine Aufgabe hatte, erwies sich für das Seelenbefinden als wichtig. Sie gab jedem Bergmann die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und damit auch das individuelle Kontrollbedürfnis (anders ausgedrückt: das Bedürfnis, über etwas die Kontrolle zu haben, in welchem Umfang auch immer) zu befriedigen.
Die Bergleute zeichneten sich durch ein hohes Maß an Selbstdisziplin aus. Die Gruppe entwickelte als Ganzes eine soziale Stärke. Man half einander und unterstützte. Von Panik, Verzweiflung oder Machtkämpfen in der Gruppe wurde nicht berichtet. Dies schließt nicht aus, dass individuell Phasen der Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung erlebt wurden. Schließlich hatten die Eingeschlossenen, bildlich ausgedrückt, ihre ganz individuellen Probleme in die Abgeschiedenheit unter Tage mitgenommen. Einige Bergleute litten schon vor diesem Unglück unter psychischen Belastungen. Manche hatten zuvor dem Alkohol intensiver zugesprochen und befanden sich auf einmal in einer Art „kalter Entzug“.
Nach ungefähr zwei Wochen waren die Essensvorräte trotz der strengen Rationierung nahezu aufgebraucht. Um ihren Flüssigkeitsbedarf in ihrem warmen und feuchten Umfeld zu decken, mussten sie das nach Metall und Altöl schmeckende Kühlwasser der Maschinen trinken.
Nachdem die Kommunikation mit der Außenwelt wieder möglich war, der Kontakt mit der Familie wieder hergestellt war, gab es wieder ein klares Ziel. Es gab etwas, worauf die Eingeschlossenen hinarbeiten konnten. Und es gab ein „wofür“, etwas, wofür es sich einzusetzen lohnte.
Wie kann Hoffnung geweckt werden?
Wohl jeder Mensch hat in seinem Leben schon einmal auf etwas gehofft oder hofft gerade jetzt auf etwas. Vielleicht ist man auf der Suche nach einer Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner zu finden, mit der bzw. dem zusammen man glücklich werden kann. Die Hoffnung wurde bzw. wird sehr strapaziert. Es hat sich noch immer nichts ergeben. Vielleicht hat man als Paar einen Kinderwunsch, aber die Schwangerschaft will sich nicht einstellen. Oder vielleicht hofft man, dass endlich ein Medikament entwickelt wird, mit dem die Krankheit, an der man leidet, besiegt werden kann. Anlässe, auf etwas zu hoffen, gibt es unendlich viele.
Wenn man selbst etwas tun kann, bemüht man sich, unternimmt das Mögliche. Aber es will einfach nicht gelingen. Einige Enttäuschungen hat man schon erlebt. Die Hoffnung ist geschwächt. Man hat sie nicht ganz aufgegeben, aber sie ist auch nicht (mehr) wirklich lebendig. Vielleicht hat man aber schon gar keine Hoffnung mehr und überlässt sich der Verzweiflung, völliger Hoffnungslosigkeit.
Macht man sich selbst etwas vor, wenn man auf etwas vergeblich hofft, manchmal sogar über lange Zeit hinweg? Es gibt Lebensumstände und Situationen, in denen Hoffnung objektiv gesehen nicht zur Realität werden kann. Aber wenn eine realistische Chance besteht, und sei sie auch noch so klein, dass sich Hoffnung erfüllen kann, kann etwas geschehen, das der Hoffnung neue Nahrung gibt. Die Hoffnung mag eingeschlafen sein, nicht wirklich präsent sein, aber sie kann wieder neu erwachen.
Oft ist es ein überraschendes Ereignis, das die Hoffnung wieder stärkt. Es ist etwas geschehen, was die kleine Hoffnungsflamme wieder nährt. Vielleicht hat man schon lange auf ein Spenderorgan gewartet, aber der erhoffte Anruf aus dem Krankenhaus kam nicht. Die Hoffnung ist eingeschlafen. Plötzlich kommt der lange ersehnte Anruf. Die Hoffnung wacht mit einem Mal auf.
Welche Macht hat Hoffnung?
Mit Hoffnung im Rücken greift man gewissermaßen nach etwas, was noch nicht Realität geworden und vielleicht sogar noch überhaupt nicht sichtbar ist. Aber Hoffnung verleiht Kraft zum Durchhalten in schwierigen Lebenssituationen, die einem ohne Hoffnung fehlt. Man kann durchhalten, auch wenn man (noch) nicht sieht, dass sich die Hoffnung erfüllt. Man bleibt beseelt von der Hoffnung, dass sich etwas zum Guten verändert und das Leben neu verankert wird.
Wenn Hoffnung Lebenskraft vermittelt und die Hoffnung nicht völlig subtanzlos ist, weshalb sollte man sich dann der Verzweiflung hingeben? In den 1970er-Jahren wurde ein fälschlicherweise Berthold Brecht zugeschriebener Spruch bekannt: „Wer kämpft, kann verlieren; wer nicht kämpft, hat schon verloren.“. In Wirklichkeit stammt dieser Spruch wohl aus der Sponti-Szene jener Zeit.
Dieser Spruch ließe sich im Hinblick auf Hoffnung etwas umformulieren: „Wer an der Hoffnung festhält, kann enttäuscht werden; wer sie aufgibt, überlässt sich gleich der Verzweiflung“. Was ist besser? Ist es besser, Hoffnung mit dem Risiko der Enttäuschung zu hegen? Oder ist es besser, ohne Hoffnung zu leben?
Was kann geschehen, wenn man hoffnungslos ist? Hoffnungslosigkeit ist gepaart mit Verzweiflung, mit Aussichtslosigkeit. Es verwundert nicht, dass Hoffnungslosigkeit krank machen und körperliche Symptome hervorrufen kann. Wenn sich die Hoffnungslosigkeit über Jahre hinzieht, können beispielsweise Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems auftreten.
Auch der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers wusste um die Gefahr der Hoffnungslosigkeit. Er formulierte: „Die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Sie ist nicht erlaubt, solange der Mensch noch etwas zu tun vermag.“.
Je stärker die Hoffnung mit Sinnhaftigkeit unterlegt ist, desto stärker ist ihre Macht. Wenn die Hoffnung beispielsweise mit der Erfüllung einer Lebensaufgabe verknüpft ist, wenn man ein „wofür“ hat, für das zu leben es sich lohnt, hat sie ein starkes Rückgrat. Die Gefahr, dass die Hoffnung einschläft, ist geringer.
Welche Rolle spielen Hoffnungsspender?
Weil es nicht einfach ist, eine eingeschlafene Hoffnung selbst wieder aufzuwecken, brauchen wir andere Menschen als Hoffnungsspender. Vielleicht ist man selbst schon geneigt, die Hoffnung aufzugeben. Aber da ist jemand, der eine andere Sichtweise einbringen und wieder Hoffnung geben kann.
Der Lebenspartner, die Lebenspartnerin, Freunde, Geschwister, sie sind es vor allem, die Hoffnung spenden und Impulse geben können, schlafende Hoffnung aufzuwecken. Sie sind es, die einen kennen und vor denen man nichts vormachen muss. Aber man muss sich selbst öffnen und andere an sich herankommen lassen.
Beziehungen zu anderen Menschen sind eminent wichtig. Wer sonst soll Anstöße geben, damit die Hoffnung (wieder) aufwacht, wenn man selbst keine Hoffnung mehr hat? Je kritischer die Situation, desto mehr sind Hoffnungsspender gefragt. Dem Impuls, sich in schwierigen Situationen in sein Schneckenhaus zurückzuziehen, muss man widerstehen. Man muss zulassen, dass jemand ein Hoffnungsspender für einen sein kann.
Es mag sein, dass man selbst kein Hoffnungsspender für einen Mitmenschen sein kann. Im konkreten Fall sieht man aus seiner Sicht keine realistische Hoffnung. Dann käme es einer Lüge gleich, Hoffnung wecken zu wollen. Davon abgesehen ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, durchschaut zu werden.
Die Chance, Hoffnungsspender für jemand zu sein oder zu werden, ist groß. Dann ist es erfüllend, zu beobachten, wie der Verzweiflung Raum genommen wird und sie sich, bildlich ausgedrückt, schlafenlegt. Die Hoffnung wacht auf und wird stärker.
* Sie können nach Text suchen, der in Zitaten vorkommt (Beispiele: „Glück“, „hoff“)