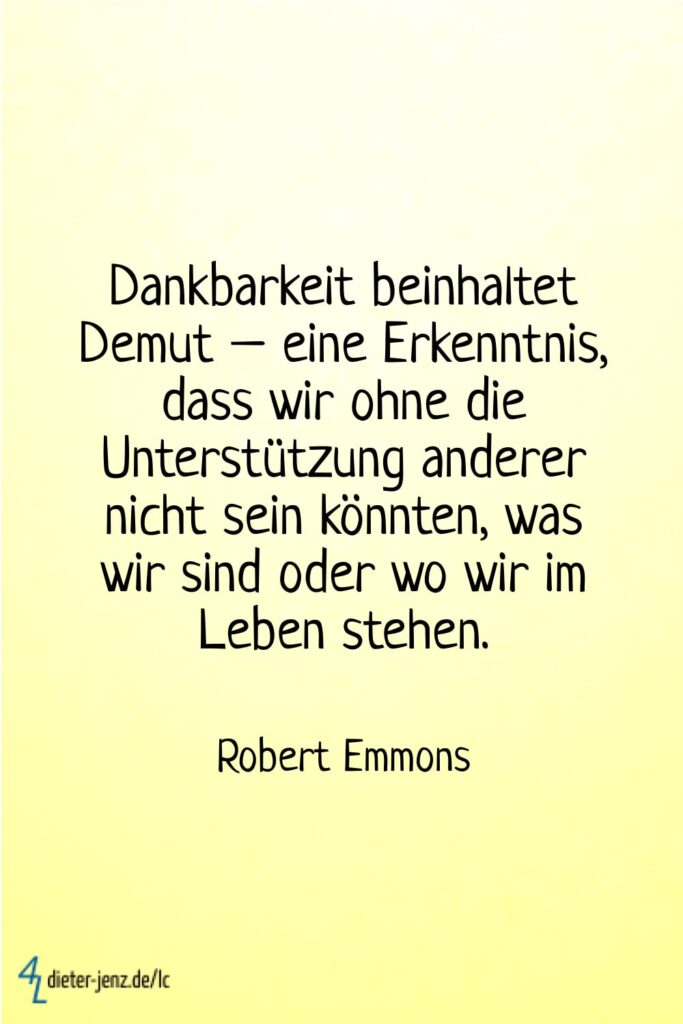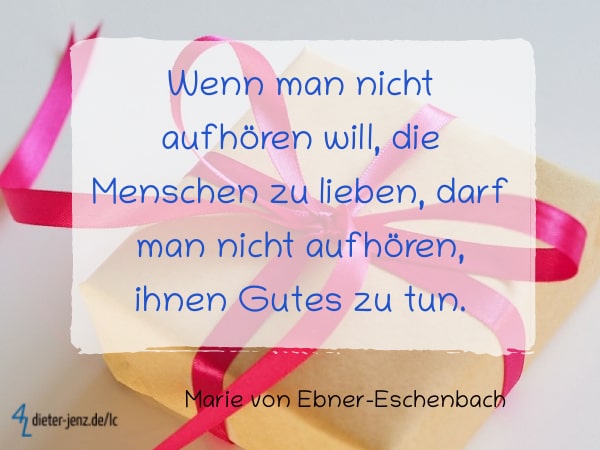„Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können.“
Jean Jaurès

Jean Jaurès (1859-1914) war ein französischer Historiker und sozialistischer Politiker. Er zählte zu den Mitgründern der Französischen Sozialistischen Partei (Parti socialiste de France, PSDF). Er vertrat einen Reformsozialismus auf humanistisch-pazifistischer Grundlage und kämpfte für die Einheit der europäischen Arbeiter. Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs fiel er einem Attentat zum Opfer.
Hoffnungsspender werden
Was ist ein Hoffnungsspender? Man stellt sich darunter eine Person vor, die einem Menschen Hoffnung geben kann, der selbst keine oder kaum mehr welche hat. Dabei kann es jedoch nicht um eine „billige“ Hoffnung in einer hoffnungslosen Situation gehen. Was würde es beispielsweise nützen, einem unheilbar erkrankten und todgeweihten Menschen zu sagen: „Es wird schon wieder“ oder „Kopf hoch! Alles wird gut!“?
Viele Menschen befinden sich in schwierigen Lebenslagen, die – objektiv betrachtet – nicht hoffnungslos sind, vom Betreffenden aber als hoffnungslos gesehen werden. Da ist beispielsweise der Mensch, der eine depressive Phase durchlebt. Er kann sich gerade nicht mehr vorstellen, dass sich sein Zustand wieder bessern könnte. Aber es gibt andere Menschen, die ihre depressive Phase hinter sich lassen konnten und ihm aus ihrer Erfahrung heraus begründete Hoffnung geben können.
Da ist beispielweise der an Krebs erkrankte Mensch, der kaum Hoffnung hat, dass ein Stammzellenspender gefunden wird. Aber Menschen, die sich auf die ein oder andere Weise tatkräftig dafür einsetzen, dass ein Stammzellenspender ausfindig gemacht wird, können ihm Hoffnung geben bzw. seine Hoffnung verstärken.
Ein drittes Beispiel: Da ist der 50-jährige Mann, der nach langer Betriebszugehörigkeit seinen Arbeitsplatz verliert. Er sieht kaum Hoffnung, wieder eine neue Arbeitsstelle zu finden, die seinem Fähigkeiten- und Kompetenzenprofil entspricht. Aber ein Freund kann ihm rücksichtsvoll in Erinnerung rufen, was er in seinem Leben schon alles geleistet und geschafft hat. Er führt ihn gewissermaßen zu seinen bereits vorhandenen Ressourcen und kann ihm dadurch Hoffnung vermitteln.
Hoffnung richtet sich auf etwas, das man noch nicht sieht. Die momentanen Umstände sprechen dagegen, dass die Situation eintritt, die man sich so sehr wünscht. Hoffnung heißt aber auch, konkret und mit gesundem Optimismus mit dem Eintreffen des Erhofften zu rechnen.
Jeder kann auf die ein oder andere Weise zum Hoffnungsspender für jemand werden. Und wenn dieser Jemand wieder Hoffnung gewonnen hat, wird er bestimmt denjenigen nicht vergessen, der ihm Hoffnung gegeben hat.
Hoffnungsspender in der Geschichte
In der Geschichte haben viele Menschen, die zu Hoffnungsspendern wurden, ihre Spuren hinterlassen. Bis heute erkennen Menschen es für sich als Aufgabe, an Missständen etwas zu ändern, und gehen auch unbequeme Wege. Lediglich drei Hoffnungsspender seien hier beispielhaft genannt.
Johann Hinrich Wiechern
Johann Hinrich Wiechern (1808-1881) übernahm im Jahr 1832 nach erfolgreichem Abschluss seines Theologiestudiums eine Stelle als Oberlehrer an der Sonntagsschule in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Georg. Der St. Georg lag damals noch vor den Toren Hamburgs und war als Elendsquartier bekannt. Wichern schloss sich einem Besuchsverein an, der die Eltern der Sonntagsschulkinder zu Hause besuchte. Bei diesen Besuchen lernte Wichern die schreiende Armut, die Wohnungsnot und die geistige wie sittliche Verwahrlosung kennen.
Die Situation der Kinder ließ Wiechern nicht unberührt. Kinder waren seinerzeit in das Erwerbsleben integriert. Kinderarbeit war üblich, sogar für Kinder unter neun Jahren. Im damaligen Königreich Preußen wurde, als Beispiel, die Arbeit von Kindern in Fabriken, Berg- und Hüttenwerken erst 1839 vollständig verboten. Dennoch durften ältere Kinder täglich bis zu zehn Stunden arbeiten. Nicht wenige Kinder gerieten auch mit der Polizei in Konflikt. Im Hamburger Kindergefängnis lebten damals mehr als 200 Kinder.
Wichern nahm sich der von ihm, aber auch vielen anderen Menschen erkannten Not der Kinder an. In ihm entfaltete sich die Vision, ein „Rettungshaus“ für Kinder zu realisieren. Die Vision wurde zum Vorhaben.
Ein Verwandter Amalie Sievekings (Mitbegründerin der organisierten Diakonie in Deutschland), der Hamburger Syndikus Karl Sieveking, überließ ihm von seinem eigenen Grundbesitz einen großen Garten mit einer strohgedeckten Bauernkate, als „Ruges Haus“ bekannt. Zusammen mit anderen Bürgern gründete Wiechern 1833 die Stiftung „Das Rauhe Haus“. Die Stiftung hatte den Zweck, ein „Rettungsdorf“ (aus dem „Rettungshaus“ wurde ein „Rettungsdorf“) für verhaltensauffällige oder straffällig gewordene arme Hamburger Kinder zu unterhalten. Diese Kinder wurden im damaligen Sprachgebrauch als „sittlich verwahrlost“ bezeichnet.
Die ersten Bewohner des Rauhen Hauses waren Johann Hinrich Wiechern selbst, seine Mutter und seine Schwester. Bis zum Jahresende 1833 konnte Wiechern 12 Jungen in die Hausgemeinschaft aufnehmen. Da die Zahl der aufgenommenen Jungen wuchs, entstand die Notwendigkeit, weitere Gebäude zu errichten. Ab 1835 konnten auch Mädchen aufgenommen werden.
Im Rettungsdorf lebten die Kinder in familienähnlichen Strukturen in Wohngruppen zusammen. Jeweils zehn bis zwölf Kinder wurden von einem Erzieher, der „Bruder“ genannt wurde, betreut. Doch verantwortliche Erzieher mussten zunächst ausgebildet und auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Also gründete Wiechern zu diesem Zweck eine Diakonenanstalt, das „Brüderhaus“.
Während ihres Aufenthalts im Rettungsdorf wurden die Kinder auf eine Lehre im Handwerk oder auf eine Tätigkeit als Dienstmädchen vorbereitet. Die Jungen halfen beim Bau der Gebäude mit und machen auf diese Weise das Rettungsdorf zu ihrem gemeinsamen Werk.
Das Rettungsdorf erlebte eine wechselvolle Geschichte. Heute ist die Stiftung „Das Rauhe Haus“ mit verschiedenen Einrichtungen, Wohngruppen und Stadtteilbüros im Raum Hamburg vertreten. Sie betreut Kinder, Jugendliche und ihre Familien, alte Menschen, geistig Eingeschränkte und psychisch Kranke.
Johann Hinrich Wiechern hätte sein Leben auch anders gestalten können. Sein Theologiestudium hätte es ihm ermöglicht, als Pastor zu wirken. Dann wäre sein Leben in völlig anderen Bahnen und vermutlich weitaus „ruhiger“ verlaufen. Aber er wurde lieber für Kinder zum Hoffnungsspender.
König Wilhelm I. von Württemberg und Königin Katharina von Württemberg
Das Jahr 1816 ging in weiten Teilen West- und Mitteleuropas als das Jahr ohne Sommer in die Geschichte ein. Grund dafür war der gewaltige Ausbruch des Vulkans Tambora im April 1815 auf der östlich von Java gelegenen indonesischen Insel Sumbawa. Die durch die Eruption freigesetzte Energie entsprach Schätzungen zufolge 170 000 Hiroshima-Bomben.
In der Folgezeit kam es weltweit zu einer Klimakatastrophe. Auch viele Gebiete West- und Mitteleuropas waren betroffen. Ihnen bescherte das Jahr 1816 einen sehr nassen und zudem sehr kalten Sommer. Bedingt durch die äußerst ungünstigen klimatischen Bedingungen reiften während der Vegetationsperiode viele Bestände landwirtschaftlicher Kulturen nicht aus.
Auch die Auswirkungen der napoleonischen Kriege machten der Bevölkerung zu schaffen. Bedingt durch diese Gemengelage war abzusehen, dass es zu einer Hungersnot und auch einer noch schärferen Wirtschaftskrise kommen würde. Das damalige Königreich Württemberg (heute auf dem Gebiet des Bundeslandes Baden-Württemberg) galt als das Armenhaus Europas.
Viele Menschen mussten auf Baumrinde, Stroh und Kleie ausweichen, um dieses zu Brot zu verbacken. Sogar Gras und Heu wurden gekocht und gegessen. Die ärmsten Menschen versuchten sich von Schlüsselblumen, Sauerampfer, Brennnesseln, Klee, Moos oder Katzenfleisch zu ernähren. Vereinzelt kam es zu Plünderungen von Mühlen und Bäckereien. Viele Menschen zogen umher und bettelten.
König Wilhelm I., der mit dem absolutistisch-autoritären Regierungsstil seines Vaters und Vorgängers Friedrich I. brach, leitete nach seinem Amtsantritt im Jahr 1816 umfassende Reformen ein. Mit verschiedenen Maßnahmen forcierte er den Ausbau der Landwirtschaft. 1818 rief er ein landwirtschaftliches Fest ins Leben, das noch heute als Cannstatter Volksfest gefeiert wird.
Königin Katharina von Württemberg widmete sich vornehmlich der Armenpflege. Sie wandte sich an wohlhabende Männer und Frauen und auf ihre Initiative hin wurden in den Gemeinden Wohltätigkeitsvereine gegründet.
Vielerlei Initiativen entstanden und gaben Menschen wieder Hoffnung. Wohlhabende Bürger schlossen sich zusammen und gründeten Kornvereine. Diese kauften Getreide in Russland, das von der Klimakatastrophe kaum betroffen war und über bedeutende Überschüsse an Getreide verfügte, und organisierten den Transport.
Endlich, im Herbst 1817 gab es im Königreich Württemberg wieder eine gute Ernte. Der Brotpreis sank kräftig und die Situation entspannte sich. Die Menschen hatten wieder genug zu essen. Aus dem rückständigen und bettelarmen Württemberg wurde ein aufstrebender Staat. Die Menschen hatten wieder Hoffnung.
Auch König und Königin hätten ihr Leben anders gestalten können. König Wilhelm I. hätte den absolutistisch-autoritären Regierungsstil fortsetzen können. Die Königin hätte die Annehmlichkeiten des Hoflebens genießen können. Aber sie entschieden sich anders und wurden zu Hoffnungsgebern vieler Menschen.
Hoffnungsspender im Kleinen
Nicht jeder Mensch kann große Hebel in Bewegung setzen, um das Leben vieler Menschen mit Hoffnung zu erfüllen. Aber jeder Mensch kann zumindest im Kleinen zu einem Hoffnungsgeber, zu einem Perspektivenschaffer, werden. Dazu werden keine besonderen Fähigkeiten und auch keine Ausbildung benötigt. Man braucht lediglich guten Willen und Zeit.
Zeit ist jedoch ein kostbares Gut. Jeder Mensch hat nur ein begrenztes Kontingent an Zeit, das sich durch die Lebensspanne zwischen Geburt und physischem Tod bemisst. Insofern schenkt jeder Hoffnungsspender etwas sehr Kostbares.
Hoffnung wirkt, bildlich ausgedrückt, wie Sauerstoff. Und Sauerstoff ist bekanntlich lebensnotwendig. Wer Hoffnung gibt, versorgt im übertragenen Sinne die Seele anderer mit Sauerstoff. Von daher erschließt sich auch, dass man sich gewissermaßen ohne große Mühe in die Reihe der größten Menschen einreihen kann.
Eine Frage stellt sich jedoch auch: Darf man sich dem überhaupt entziehen, Hoffnungsspender zu sein? Für Karl Theodor Jaspers, Psychiater und Philosoph, war die Antwort eindeutig: „Hoffnungslosigkeit aber darf es nicht geben, wenn Menschen mit Menschen leben.“
* Sie können nach Text suchen, der in Zitaten vorkommt (Beispiele: „Glück“, „hoff“)