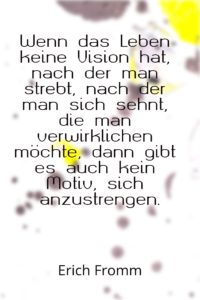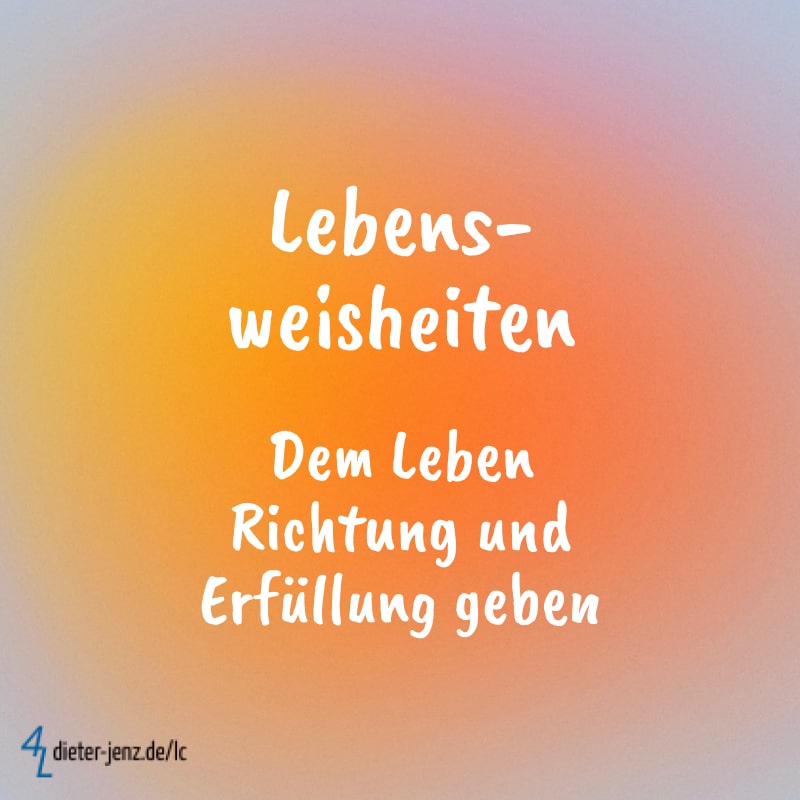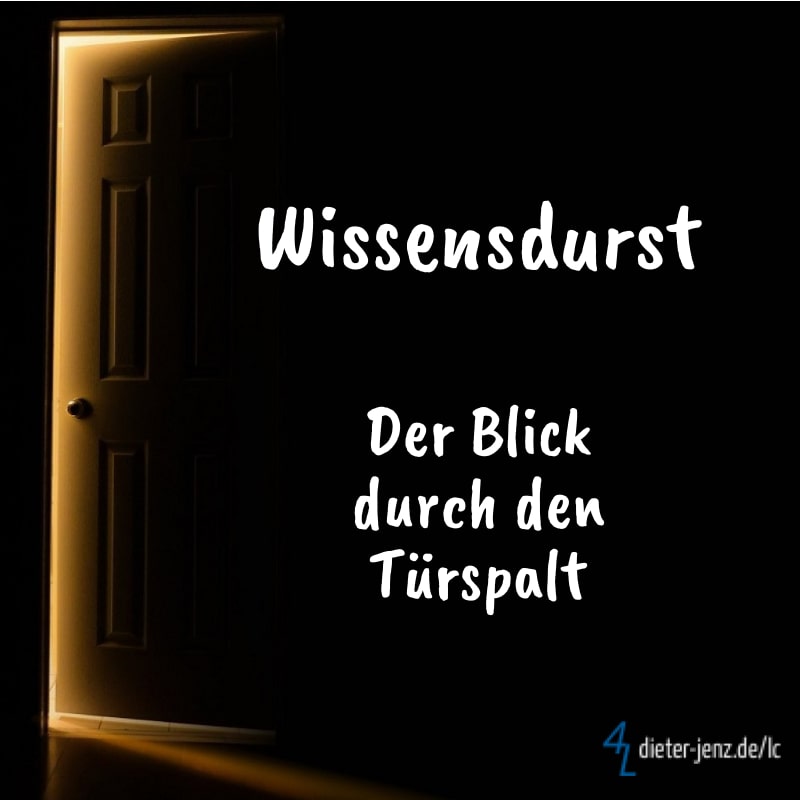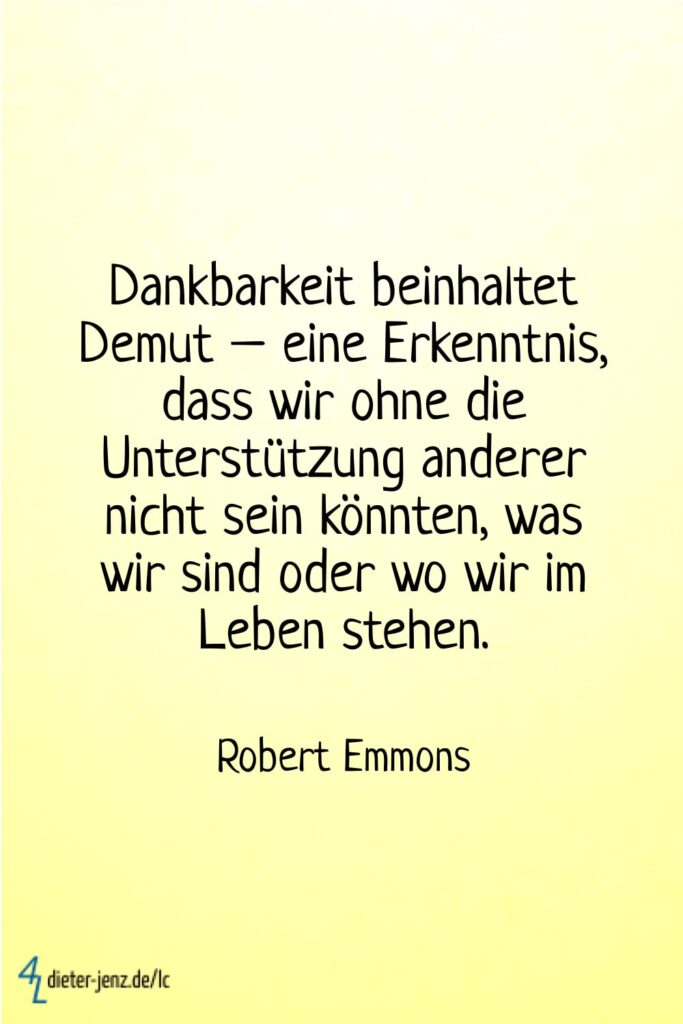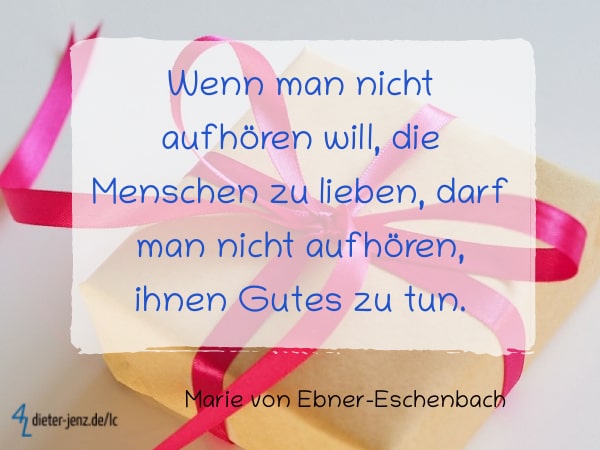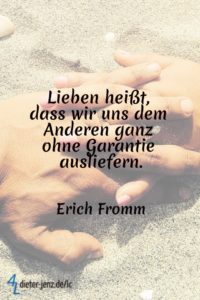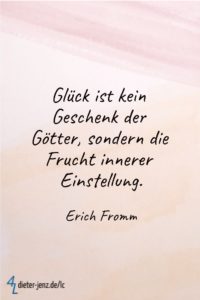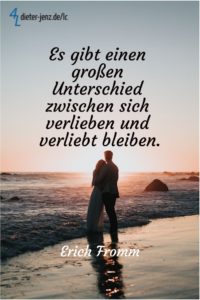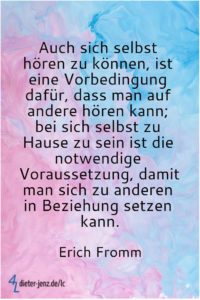„Wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es auch kein Motiv, sich anzustrengen.“
Erich Fromm
Erich Fromm (1900-1980) war ein deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe. Er versuchte, psychologisches und soziologisches Denken zu verbinden. Für Fromm ist die Freiheit zentrales Kriterium der menschlichen Natur.
Sein Hauptinteresse galt der Erforschung der psychischen Voraussetzungen für ein gelingendes gesellschaftliches Zusammenleben. Seine Beiträge zur Psychoanalyse, zur Religionspsychologie und zur Gesellschaftskritik haben ihn als einflussreichen Denker des 20. Jahrhunderts etabliert.
Die Lebensvision – jede Mühe wert
Eine Vision bezeichnet das innere Bild einer meist auf die Zukunft bezogenen Vorstellung. Die Vorstellung illustriert mehr oder weniger konkret einen Zustand, den man im Leben erreichen möchte. Auf das Leben bezogen ist eine Vision naturgemäß mit etwas verbunden, was einen innerlich antreibt, was einen erfüllt und was einem sehr erstrebenswert erscheint. Wohl niemand würde eine Vision für etwas entwickeln, was einen nicht erfüllt und deshalb in der praktischen Umsetzung ständig Überwindung kostet.
Hat das Leben für mehr als eine Vision Raum? Wohl kaum. Meistens ist es diese eine Vision, die dem Leben als Lebensvision ein Ziel gibt. Sie bestimmt einen bedeutenden Teil des Lebens und gibt ihm Struktur.
Wann entsteht in einem Menschen seine Lebensvision? Es gibt keine Altersgrenze. Man kann praktisch in jedem Alter von seiner Lebensvision „gepackt“ werden. Manche Menschen kennen ihre Lebensvision schon im Kindes- oder Jugendalter. Und manche lernen sie erst später kennen, wenn sie einiges an Lebenserfahrung gewonnen haben oder wenn ein besonderes Ereignis in ihrem Leben eingetreten ist.
Gelebte Lebensvision – eine faszinierende Geschichte
Ein Ärzte-Ehepaar Dr. Klaus-Dieter und Dr. Martina John, er Chirurg, sie Kinderärztin, entschied sich schon während des Studiums gegen eine berufliche Karriere in Deutschland. Sie wollten vielmehr für Menschen in einem Land der Dritten Welt da sein. Ihr Weg führte sie über verschiedene Stationen auf mehreren Kontinenten schließlich nach Südamerika, in ein Urwaldkrankenhaus am Rand des ecuadorianischen Dschungels, gewissermaßen ein „Lambarene am Osthang der Anden“.
Für ihren Lebensunterhalt mussten die Johns selbst sorgen. Über Spendenaufrufe bildete sich im Verlauf einer einjährigen Öffentlichkeitsarbeit ein Unterstützerkreis, der die regelmäßig benötigte Summe für den Chirurgen und die Kinderärztin aufbrachte.
Immer wieder bewegten die Johns den Gedanken, ein Krankenhaus für die Armen zu bauen. Im Lauf der Zeit nahmen sie wahr, dass von der Krankenhausdirektion eine Reihe armer Patienten abgewiesen wurde, da im Wohltätigkeitsfonds des Krankenhauses nicht genügend Geld vorhanden war. Der heimliche Herzenswunsch, ein Krankenhaus in den Anden zu bauen, das insbesondere die Armen im Blick hatte, wurde immer stärker und dringlicher.
Geburtsstunde einer Vision
In seinem Buch mit dem provokanten Titel: „Ich habe Gott gesehen: Diospi Suyana – Hospital der Hoffnung“ (Brunnen Verlag) berichtet Klaus-Dieter John von der Geburtsstunde seiner Vision, die er auf den 27. September 2000 datierte. Aus einem Wunsch wurde eine Vision.
In der Folgezeit begannen die Johns mit konkreten Planungen. Als Ärzte hatten sie jedoch zum einen keinerlei Ahnung von der Planung von Krankenhäusern, zum anderen fehlte das Geld. Sie waren auf Unterstützung von Fachleuten angewiesen und mussten außerdem auch dafür sorgen, dass eine solide Basis an finanzieller Unterstützung entstand.
Bis zum Beginn des Jahres 2002 geschah nichts Wesentliches, was die Realisierung der Vision vorangebracht hätte. Schließlich war in dem Krankenhaus, in dem beide arbeiteten, genug zu tun.
Die Jetzt-oder-nie-Entscheidung
„Wir sind schon über 40 Jahre alt. Entweder wir packen das Projekt jetzt an oder nie!“. Mit dieser Feststellung Martina Johns kam wieder Bewegung in das Vorhaben. Klaus-Dieter John machte sich an einen Projektentwurf, in dem das Vorhaben hinsichtlich Projektumfang, möglichem Standort, Finanzierung, Leitungsstruktur usw. genauer beschrieben wurde. Für Bau und Ausrüstung wurden zwischen 2 und 3 Millionen US-Dollar veranschlagt. Nach mehrmonatiger Arbeit wurde der Projektentwurf im Sommer 2002 an Freunde und Bekannte verschickt.
Am 23. Dezember 2002 war im Handelsblatt zu lesen: „Konjunktur 2002: Binnenwirtschaft liegt am Boden – Export hat das Schlimmste verhindert“. Weiter hieß es in dem Artikel: „Vor allem die zweite Jahreshälfte, auf die die Prognostiker bis in den Sommer hinein all ihre Hoffnungen gesetzt hatten, sie war eine Zeit der gefühlten Rezession. Formal hat das Land keine neue Rezession erlebt. […] Und dennoch empfanden viele Deutsche die abgelaufenen zwölf Monate als härtestes Jahr seit der Rezession von 1993.“.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren in der deutschen Heimat nicht gerade günstig, als die Johns nach Deutschland reisten, um die für die finanzielle Unterstützung notwendigen Strukturen zu schaffen. Von ihrer Begeisterung schien sich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zunächst niemand so richtig anstecken zu lassen. Dennoch fanden sich einige Personen für die Vereinsgründung.
Wieder in Südamerika zurück, erfolgte nun die Suche nach einem geeigneten Standort für das Krankenhaus. Die Wahl fiel schließlich im Januar 2003 auf Curahuasi in Peru. Einige Monate später konnte mit Hilfe von Spendengeldern das Grundstück für das künftige Krankenhaus erworben werden.
Fast gescheitert
Anfang 2004, wieder zurück in Deutschland, begannen die Johns mit der Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit. Das Vorhaben sollte in den Medien vorgestellt werden und über Vorträge und Präsentationen sollte ein Unterstützerkreis aufgebaut werden. Dies geschah bei relativ schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.
Die Süddeutsche Zeitung berichtete rückblickend in einem Artikel mit dem Titel „2004 war erneut ein düsteres Jahr“: „Mit im Schnitt knapp 4,4 Millionen Arbeitslosen hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland im abgelaufenen Jahr den höchsten Stand seit 1997 erreicht.“. Weiter war zu lesen: „Die Arbeitslosenquote betrug im Jahresdurchschnitt wie im Jahr 2003 10,5 Prozent. Ohne die Statistikänderung, durch die Teilnehmer an Qualifizierungs- und Trainingsmaßnahmen nicht mehr als arbeitslos gelten, hätte sie sogar bei 10,7 Prozent gelegen.“. Jeder vierte Bundesbürger war in Sorge, innerhalb der nächsten sechs Monate seinen Arbeitsplatz zu verlieren.
Trotz großen Engagements zeigte die Öffentlichkeitsarbeit nicht die erhoffte Wirksamkeit. In seinem Buch schrieb Klaus-Dieter John: „Wir mussten später noch etliche Durststrecken durchlaufen, aber besonders das erste halbe Jahr entwickelte sich zu einem Tal der Tränen. Angesichts der Größe unseres Vorhabens waren wir Ende Juni 2004 eigentlich gescheitert. Die Last lag zentnerschwer auf Tina und mir. Vielleicht hätten wir an diesem Punkt fast aufgegeben, aber wir hofften schlichtweg auf ein Wunder, ja auf den großen Durchbruch.“.
Der erhoffte Durchbruch wird Realität
Ein langer Artikel in der Zeitschrift „Family“, auch getragen von einem innerlich berührten Chefredakteur, brachte schließlich den erhofften Durchbruch. Das Vorhaben wurde von vielen weiteren Medienunternehmen aufgegriffen und wurde dadurch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Das Spendenaufkommen wuchs.
Parallel versuchte Klaus-Dieter John, weitere Kontakte zu knüpfen, um die benötigte medizinische Ausrüstung (OP-Tische, Narkosegeräte, chirurgische Instrumente usw.) zu beschaffen. In vielen persönlichen Gesprächen gelang es, die Unterstützung von Unternehmen dieser Branche zu gewinnen.
Neben der Ausrüstungsakquisition mussten auch die vertraglichen Grundlagen für das mehrere Millionen US-Dollar „schwere“ Bauprojekt geschaffen werden. Außerdem musste eine geeignete Person gefunden werden, die hinsichtlich der Bauleitung eines Großprojekts entsprechende Erfahrung mitbrachte und ehrenamtlich tätig wurde.
Das Krankenhaus entsteht
Am 24. Mai 2005 erfolgte in Anwesenheit des deutschen Botschafters der symbolische erste Spatenstich. Einige Wochen später begannen die Bauarbeiten. Im Laufe der folgenden Jahre waren vielerlei Schwierigkeiten und Probleme, technischer wie personeller und finanzieller Art, zu bewältigen.
Schließlich war es am 31. August 2007 so weit: die feierliche Einweihung des Krankenhauses „Diospi Suyana“ konnte in Anwesenheit der Gattin des peruanischen Präsidenten, des peruanischen Gesundheitsministers und vieler weiterer Ehrengäste stattfinden. „In den Bergen Südperus war ein Klinikum mit modernster Technik, ausgestattet mit Computertomografie und Solaranlage, entstanden. In Zukunft würden hier bis zu 100 000 Berglandindianer im Jahr medizinisch versorgt werden können.“, so Klaus-Dieter John in seinem Buch.
Zur Inbetriebnahme, die einige Wochen später nach Erledigung wichtiger Restarbeiten erfolgte, schrieb er: „Am 22. Oktober 2007 morgens um 8.50 Uhr war es so weit: Ein alter Quechua-Indianer trat als erster Patient über die Schwelle der Eingangstür. Das Hospital Diospi Suyana hatte genau 2 Jahre und 5 Monate nach dem ersten Spatenstich offiziell seinen Dienst aufgenommen.“.
Rechtzeitig vor der Inbetriebnahme hatte sich auch ein Team von freiwilligen Mitarbeitern mit den benötigten Fachkompetenzprofilen zusammengefunden. Im Buch heißt es über sie: „Sie kamen aus den unterschiedlichsten Kirchen und Gemeinden, teilten aber die gleiche Überzeugung, dass der Glaube an Gott sich niemals in einer weltfremden Frömmelei erschöpfen darf. Vielmehr wollten sie ihre Ärmel hochkrempeln und anpacken.“. Über sein eigenes Motiv schrieb Klaus-Dieter John: „Mein eigenes Motiv, das Projekt voranzutreiben, lag in meiner intensiven Sehnsucht nach einem erfahrbaren Gott begründet.“. In der Tat durchzogen eine Vielzahl menschlich nicht erklärbarer Fügungen das gesamte Vorhaben. Der Buchtitel nimmt darauf Bezug, wobei das „Ich habe Gott gesehen“ nicht wörtlich zu verstehen ist
Lebensvision und Lebensaufgabe – ein Zusammenhang?
Eine Vision lebt zum einen von der verstandesmäßigen Überzeugung, etwas Sinnstiftendes möglich machen zu können. Zum anderen lebt sie von tief empfundener emotionaler Zuneigung. Man verschreibt sich etwas „mit Haut und Haaren“, man brennt dafür. Es gibt ein Motiv, sich anzustrengen. Und nur so lassen sich auch Durststrecken aushalten.
Lebensvision und Lebensaufgabe stehen in einem sehr engen Zusammenhang und ergänzen sich. Der Begriff „Lebensaufgabe“ bezeichnet eine Aufgabe, der jemand sein ganzes Leben widmet, die einen lebenslang beansprucht. Insofern ist „Lebensvision“ vorstellungsorientiert und „Lebensaufgabe“ ist mehr tätigkeitsorientiert.
Kommt zeitlich zuerst die Lebensvision und dann die Lebensaufgabe oder geht die Lebensaufgabe der Lebensvision zeitlich voran? Eine eindeutige Antwort gibt es wohl nicht.
Manche Menschen kennen ihre Lebensaufgabe, kümmern sich aber nicht darum, welchen konkreten Zustand sie erreichen möchten. Sie gehen in ihrer Aufgabe auf und konzentrieren sich auf ihre Tätigkeit. Alles andere ist ihnen nicht so wichtig. Sie haben gewissermaßen eine Lebensaufgabe, aber keine Lebensvision oder die Lebensvision ist nicht konkret formuliert.
Andere wiederum haben eine Lebensvision, aus der sich die Lebensaufgabe entwickelt, gewissermaßen als Konkretisierung der Lebensvision. Die Lebensvision prägt und gibt der Lebensaufgabe einen mehr operativen Charakter.
* Sie können nach Text suchen, der in Zitaten vorkommt (Beispiele: „Glück“, „hoff“)