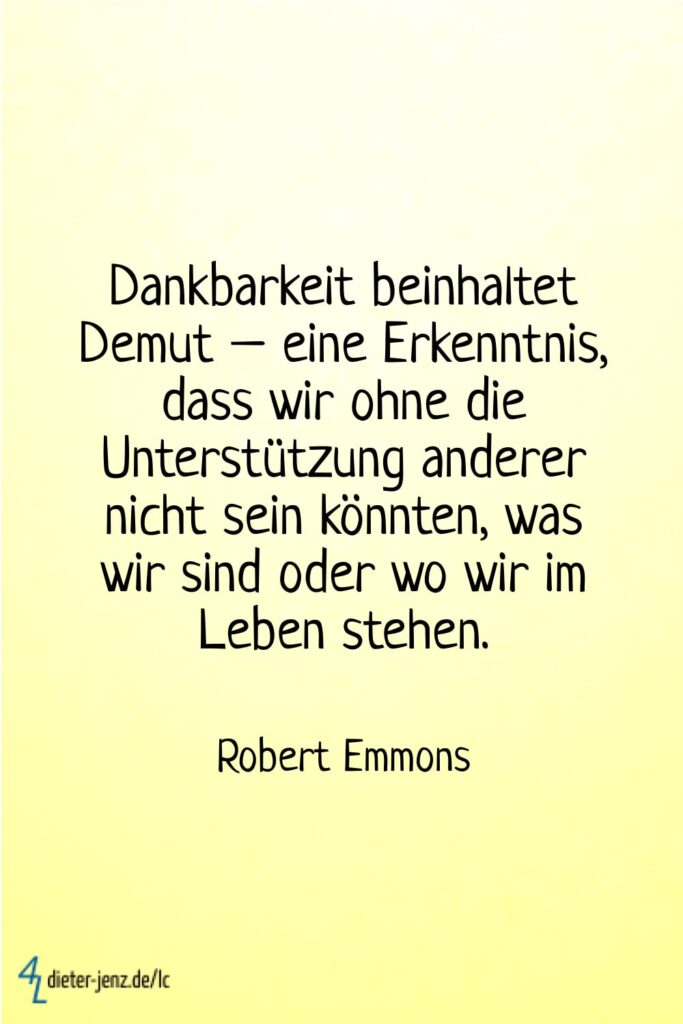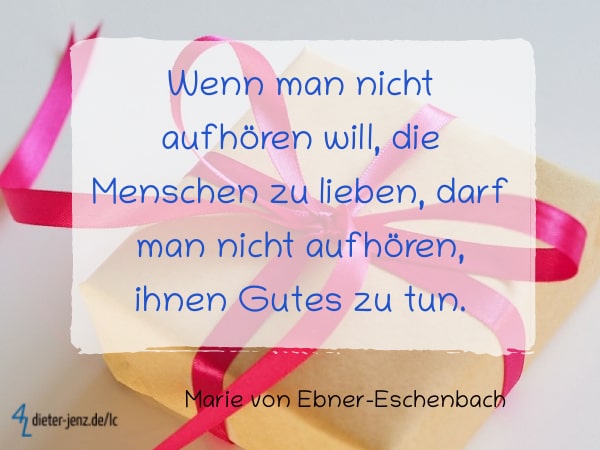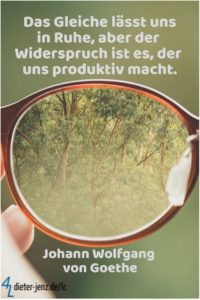„Wer nichts für andere tut, der tut nichts für sich.“
Johann Wolfgang von Goethe
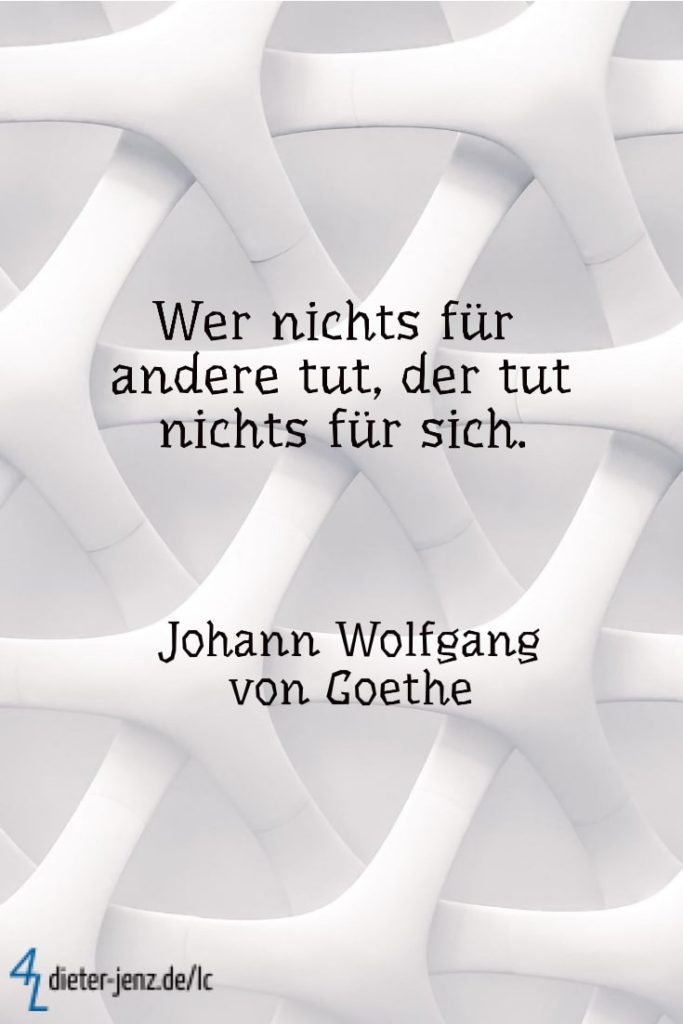
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war ein deutscher Dichter, Naturforscher und Politiker. Nicht nur in Deutschland gilt er als einer der bedeutendsten Schöpfer deutschsprachiger Dichtung.
Etwas für andere tun – ist es immer so einfach?
Monika (Name geändert) ging es nicht gut. Sie befand sich in einer depressiven Episode. Auf die Idee, etwas für andere zu tun, sich vielleicht ehrenamtlich zu engagieren, um Selbstisolierungstendenzen entgegen zu wirken, wollte sie nicht eingehen. Es war ihr zu viel. Ihre Depression war schon weit fortgeschritten.
Menschen, die sich in einer depressiven Episode befinden, leiden unter deutlich vermindertem Antrieb und verminderter Aktivität. Insbesondere bei einer mittelgradigen oder schweren Depression ist die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die Konzentration erheblich eingeschränkt. Es fällt ihnen deshalb in einer depressiven Episode schwer, für andere etwas zu tun. Davon abgesehen besteht die Gefahr, dass das bestehende Beziehungsnetz mit Familienangehörigen, Verwandten, Freunden usw. reißt. Betroffene ziehen sich oft selbst zurück, aber oft ziehen sich auch Mitmenschen vom Betroffenen zurück. Der Weg zur sozialen Isolation kann mitunter kurz sein.
Monikas Situation steht deshalb am Anfang dieses Beitrags, weil leicht der Schluss gezogen werden kann: „Wer nichts für andere tut, der tut nichts für sich und braucht sich nicht zu wundern, wenn es ihr bzw. ihm nicht gut geht.“. Diese Schlussfolgerung wäre fatal.
Etwas für sich tun – auf dem Umweg über andere?
Goethes Aussage lässt sich umkehren und etwa so formulieren: „Wer etwas für andere tut, der tut etwas für sich.“. Aber was genau tut man für sich, wenn man für andere etwas tut?
Neurowissenschaftliche Studien legen nahe, dass Freundlichkeit und Mitgefühl unsere Gehirnaktivitäten beeinflussen. Diese beeinflussen wiederum Körper, Seele und Geist und damit auch unser Wohlbefinden. Wenn beispielsweise in der Beziehung zu einem anderen Menschen ein Gefühl tiefer Nähe empfunden wird oder wir uns ganz generell um das Wohl anderer kümmern, reagiert das Gehirn mit der Ausschüttung des Hormons und Neurotransmitters Oxytocin. Oxytocin, oft auch als „Kuschelhormon“ oder „Bindungshormon“ bezeichnet, verringert den Blutdruck und senkt den Kortisolspiegel. Das Hormon steigert zugleich das Wohlbefinden und fördert ein positives soziales Miteinander.
Unter diesem Vorzeichen verwundert nicht, dass sich beispielsweise Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, glücklicher und gesünder fühlen als ihre Mitmenschen, die ohne soziales Engagement sind. Für andere etwas tun, beispielsweise bei der Freiwilligen Feuerwehr, führt in soziale Kontakte und Beziehungen. Und es führt auch zu der Chance, im sozialen Miteinander, im Wirken für eine gemeinsame Sache, ein Gefühl tiefer Nähe zu empfinden.
In den letzten Jahrzehnten wurden vielerlei Untersuchungen durchgeführt, die sich um die Frage drehten, was Menschen glücklich und zufrieden macht. Besonders die „Grant Study“ und die „Glueck Study“, zwei 1938 begonnene Langzeitstudien, konnten zeigen, dass ein erfülltes Sozialleben Wohlbefinden und Zufriedenheit steigert. Studienteilnehmer, die engere soziale Kontakte zu Familie und Freunden pflegten und in ein weiter gespanntes soziales Umfeld (z. B. eine Gemeinschaft) eingebunden waren, waren im Schnitt glücklicher, körperlich gesünder und lebten länger. Selbst gewählter oder auch erlittener Rückzug aus sozialen Beziehungen in die Einsamkeit wirkte sich hingegen nachteilig auf die körperliche Gesundheit und auch auf die Lebenserwartung aus. Einsamkeit hat, so lässt sich als Erkenntnis folgern, in der Tat eine toxische Wirkung.
Wie kann man vorgehen, um Wohlbefinden zu erleben?
Wenn es so ist, dass sich Oxytocin, wie schon erwähnt, positiv auf das Wohlbefinden und das soziale Miteinander auswirkt, liegt der Gedanke nahe, sich einfach Oxytocin selbst zu verabreichen. Dann würde man gewissermaßen das Wohlbefinden bei sich „anknipsen“. In der Tat gibt es in manchen Ländern ein Oxytocin-Nasenspray zu kaufen (in Deutschland ist es verschreibungspflichtig). Ärzte und Psychologen warnen jedoch vehement vor Selbstversuchen.
Nachdem ein einfaches „Anknipsen“ von Wohlbefinden durch ein Medikament nicht möglich ist, bleibt nur der Weg über soziale Beziehungen, denn diese machen – den Erkenntnissen der erwähnten Langzeitstudien zufolge – glücklich und zufrieden. Dies bedeutet, dass man selbst aktiv werden muss. Doch wie könnte man konkret vorgehen? Sollte man einfach versuchen, über soziale Medien (z. B. Facebook) so viele Kontakte wie nur möglich gewinnen? Oder wäre es besser, sich auf wenige soziale Kontakte zu beschränken? Mit anderen Worten: Soll es um Quantität oder Qualität der sozialen Beziehungen gehen?
Die Studienergebnisse deuten sehr klar darauf hin, dass die Qualität der Beziehungen entscheidend ist. Vertrauensvolle Beziehungen zu Familienmitgliedern, Freunden und sonstigen nahestehenden Personen haben zwei Seiten: man wird von anderen so akzeptiert, wie man ist, und man kann sich auch selbst anderen anvertrauen, wenn man sich in einer schwierigen Lebenssituation befindet.
Vielleicht empfindet man gerade einen Mangel an „Qualitätsbeziehungen“. Doch so muss es nicht bleiben. Wiederum deuten wissenschaftliche Untersuchungen darauf hin, dass „Qualitätsbeziehungen“ auch eine Frage der Gelegenheit sind. Wenn sich Mitmenschen in dauerhafter und unmittelbarer Nähe befinden, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich mit der Zeit freundschaftliche Beziehungen entwickeln. Dies gilt umso mehr, wenn man auch gemeinsame Interessen teilt, wie beispielsweise bei einer ehrenamtlichen Tätigkeit mit einem gemeinsamen Anliegen.
Für andere etwas tun – ein Ausdruck von Gestaltungskraft?
Soziale Beziehungen sind ein Geben und Nehmen. Wenn jemand nur nehmen würde, entstünde schnell ein Ungleichgewicht in der Beziehung, das diese belastet. Das Nehmen ist nicht produktiv, es schafft nichts Neues. Wenn man nur nehmen will, stellt man sich selbst an den Rand.
Im Geben kommen hingegen Produktivität und individuelle Gestaltungskraft zum Ausdruck. Sir Winston Churchill stellte einen Zusammenhang her: Man braucht ein Einkommen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und die Ausgaben zu finanzieren. Aber durch das Geben wird das Leben aktiv und produktiv gestaltet. Er formulierte es so: „Wir leben von dem, was wir bekommen, aber wir gestalten unser Leben durch das, was wir geben.“.
Natürlich muss es sich beim Geben nicht um das Geben von Geld handeln. Das Geben kann auch seinen Ausdruck im „etwas für andere tun“ finden. Wenn man jedenfalls seine Gestaltungskraft einsetzt, in welchem Umfang auch immer, nimmt man sich als wirksam wahr.
Tönt „Gestaltungskraft“ nicht etwas hochgestochen? Man denkt vielleicht, dass es nichts Besonderes ist, was man tut. Aus der subjektiven Sicht heraus mag es sogar etwas relativ Unbedeutendes sein. Vielleicht hält man es aber auch einfach für etwas Notwendiges, für das man sich aber gerne einsetzt. Wie auch immer: man besitzt Gestaltungskraft und man entscheidet sich aus freiem Willen dafür, sie aktiv einzusetzen.
Gibt es eine Wechselwirkung – falls ja, welche?
Der Theologe Dietrich Bonhoeffer befindet sich auf einer Linie mit den Erkenntnissen aus mittlerweile zahlreichen Studien. Er drückte es so aus: „Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl, als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann.“. Wenn man für andere etwas tut, ist man gleichzeitig auch etwas für andere.
Wenn man etwas gerne tut und sich nicht ausgenützt fühlt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man in den sozialen Beziehungen Wohlbefinden und Zufriedenheit erlebt. Andererseits begünstigen Wohlbefinden und Zufriedenheit soziale Beziehungen. Fühlt man sich wohl und zufrieden, ist man sehr viel eher geneigt, Kontakte zu knüpfen und sich auf Menschen einzulassen. Es gibt demnach eine Wechselwirkung.
Würde man kein Gefühl des Wohlbefindens und der Zufriedenheit erleben, wäre man sicherlich sehr viel weniger geneigt, für andere etwas zu tun. Und man hätte dann auch viel weniger Anknüpfungspunkte für neue soziale Beziehungen.
Etwas für andere tun, hat in der Gesamtschau den Charakter der Einsamkeitsprophylaxe. Wer für andere etwas tut, wird nicht einsam sein. Um die Wirkungskette jedoch „in Gang zu setzen“, muss man selbst aktiv werden.
Vielleicht ist man aber auch von seinen Mitmenschen enttäuscht. Und man sagt sich: „Wenn andere nichts für mich tun, dann tue ich auch nichts für andere“. Dann jedoch bleibt man in der Bewegungslosigkeit gefangen. Man wird vermutlich lange warten müssen, denn man strahlt auch etwas aus. Auf andere wirkt man nicht anziehend, sondern eher verschlossen. Weshalb sollten andere sich um einen kümmern?
Ein Experiment wagen?
„Probieren geht über Studieren“, so lautet ein altbekanntes Sprichwort. Etwas anders ausgedrückt: „Es gibt nichts Besseres, als selbst Erfahrungen zu machen“. Was man selbst an Erfahrung gesammelt hat, ist sehr viel nachhaltiger als das, was man sich nur angelesen hat.
Vielleicht kennt man jemand, dem es gerade nicht so gut geht. Dann könnte man vielleicht anrufen und versuchen, Mut zu machen und Hoffnung zu geben. Oder man schreibt einen Brief oder eine Karte. Und man könnte sich erkundigen, ob man etwas für diese Person tun kann.
Wenn man noch keine Idee hat, wie man für andere etwas tun kann, können die mancherorts vorhandenen Ehrenamts- oder Freiwilligenagenturen dabei unterstützen, etwas Geeignetes für sich zu finden. Sucht man zunächst eine Möglichkeit, sich einmalig einzubringen, gewissermaßen zum „Schnuppern“, bieten sich beispielsweise die folgenden Möglichkeiten an: einem Kind etwas vorlesen, ein Grundschulkind bei den Hausaufgaben unterstützen oder bei der Durchführung eines Basars helfen.
Während dieses kleinen Experiments könnte man sich selbst beobachten. Wie fühlt es sich gerade an, während man für jemand etwas tut? Und wie fühlt es sich an, nachdem man etwas Gutes getan hat?
Man muss nicht unbedingt mehrere Stunden pro Woche etwas für andere tun, um für sich selbst etwas zu tun. Man kann ganz klein anfangen, mit dem Experiment. Ein Experiment kann schiefgehen. Wenn man nicht zufrieden ist, kann man sich anderweitig orientieren. Und wenn man Wohlbefinden und Zufriedenheit erlebt, kann man in diesem Bereich auch mehr für andere tun, wenn man die Möglichkeiten dazu hat und es möchte.
Selbst bei einer leichten Depression kann das „etwas für andere tun“ helfen. Alfred Adler, Arzt und Psychotherapeut, stellte einen Zusammenhang zwischen „etwas für andere tun“ und Depressionen her. Er formulierte durchaus etwas provozierend: „Wir können uns in nur vierzehn Tagen von unseren Depressionen befreien, wenn wir uns nur jeden Tag überlegen, wie wir anderen helfen können.“.
* Sie können nach Text suchen, der in Zitaten vorkommt (Beispiele: „Glück“, „hoff“)